Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 Pädagogik bei
Schulschwierigkeiten
Diplomarbeit
Metakognition
in der Volksschule
Eine Erhebung zum Einsatz
metakognitiver Unterrichtsformen von der 1. bis zur 9. Klasse

Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 Pädagogik bei
Schulschwierigkeiten
Diplomarbeit
Metakognition
in der Volksschule
Eine Erhebung zum Einsatz
metakognitiver Unterrichtsformen von der 1. bis zur 9. Klasse

Wir werden
nun die Resultate unserer Befragung darstellen. Mit Hilfe der Daten aus unserem
Fragebogen wollen wir herausfinden, ob Lehrpersonen, die im Berufsalltag stehen,
den Begriff Metakognition kennen und ob diese Unterrichtsformen im Schulalltag
auch tatsächlich eingesetzt werden. Dies wird aus Kapitel 6.1 ersichtlich.
Weiter interessiert uns, wie häufig die verschiedenen metakognitiven
Unterrichtsformen eingesetzt werden und wie die Aspekte Klassengrösse, das Tätigkeitsgebiet
einer Lehrperson, der Anteil Kinder mit Deutsch als Zweitsprache und das Schulalter
den Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen beeinflussen. Dies beschreiben wir
im Kapitel 6.2.
Anschliessend möchten wir herausfinden, welche Erfahrungen die
Lehrpersonen mit dem Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen gemacht haben
und welche Hindernisse dabei aufgetreten sind und stellen dies im Kapitel 6.3 dar.
Im Kapitel 6.4 gehen wir der Frage
nach, inwiefern die Anzahl Jahre Berufserfahrung und das Geschlecht einen
Einfluss auf den Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen haben.
In jedem Kapitel werden die Resultate zuerst beschrieben und
anschliessend interpretiert. Falls die Auswertung der Daten hypothesengeleitet
erfolgt ist, fügen wir der Interpretation zusätzlich eine Diskussion an, in der
die Hypothese – bezogen auf unsere Fragestellung – entweder
verifiziert oder falsifiziert wird. Wir beenden das Kapitel jeweils mit einer
kurzen Zusammenfassung der für uns wichtigen Aussagen.
Auf der beigelegten CD-Rom befinden sich sämtliche Roh- und
Diagrammdaten, die auf den Antworten zum Fragebogen basieren. Falls
weiterführende Diagramme erstellt wurden, die nicht in der Arbeit enthalten
sind, werden wir speziell darauf hinweisen. Die gesamten Inhalte sind ebenfalls
im Internet unter der Adresse http://www.metakognition.ch.vu
ersichtlich.
6.1
Bekanntheit und Verbreitung des
Konzepts Metakognition
Als erstes werden wir nun die Ergebnisse zu den Fragen nach der
Bekanntheit des Begriffes Metakognition und der Verbreitung der Anwendung der
metakognitiven Unterrichtsformen darstellen und interpretieren.
6.1.1
Bekanntheit des Begriffes Metakognition
Im
Fragebogen wurden die Lehrpersonen danach befragt, ob ihnen der Begriff der
Metakognition bekannt sei. Dabei wurde der Begriff nicht näher definiert oder
umschrieben. Es bestand allerdings die Möglichkeit, sich über einen Link im
Fragebogen nähere Informationen darüber zu holen.
Wir werden
nun diese Resultate analysieren. Da die Frage sehr eng mit der Frage nach der
Verbreitung des Konzepts Metakognition verknüpft ist, folgt die Interpretation
und Zusammenfassung beider Fragestellungen zusammen erst am Schluss des
Folgekapitels unter 6.1.2.2 und 6.1.2.3.
6.1.1.1 Analyse der Resultate zur Bekanntheit des Begriffes Metakognition
Von den 103 ausgefüllten Fragebogen geben 85 der befragten Lehrpersonen
an, den Begriff Metakognition schon einmal gehört zu haben. Demgegenüber stehen
18 Lehrpersonen, die den Begriff Metakognition vor dem Ausfüllen unseres
Fragebogens noch nicht gekannt haben. Diese Zahlen werden im Diagramm 1 grafisch dargestellt.
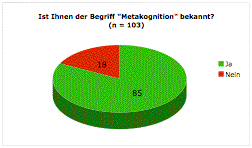
Diagramm 1: Bekanntheit des
Begriffes Metakognition
Lehrpersonen,
welche angeben, den Begriff Metakognition bereits gehört zu haben, haben wir anschliessend
gefragt, in welchem Zusammenhang sie auf diesen Begriff gestossen sind. Dabei
waren Mehrfachnennungen möglich. 53 Lehrpersonen geben an, in der Ausbildung
davon gehört zu haben, 46 Personen kennen den Begriff von Weiterbildungen her,
15 von Lehrerkolleginnen und -kollegen und 21 Personen sind anderweitig auf den
Begriff Metakognition gestossen. 16 dieser 21 Lehrpersonen geben an, in der
Literatur dem Begriff begegnet zu sein, vier Lehrpersonen machten diverse und
eine Lehrperson machte keine Angaben. Diese Zahlen sind aus dem Diagramm 2 ersichtlich.
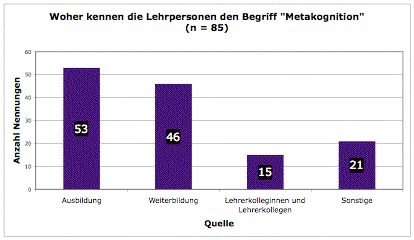
Diagramm 2: Woher kennen die Lehrpersonen den Begriff Metakognition?
6.1.2
Verbreitung des Konzepts Metakognition
Nun stellen
wir den Lehrpersonen die Frage, ob metakognitive Unterrichtsformen bereits im
eigenen Unterricht angewendet wurden. Zu diesem Zweck werden im Fragebogen
verschiedene metakognitive Unterrichtsformen aufgezählt und kurz beschrieben.
6.1.2.1 Analyse der Resultate zur Verbreitung des Konzepts Metakognition
98
Lehrpersonen geben an, mit metakognitiven Unterrichtsformen bereits gearbeitet
zu haben. Demgegenüber sind fünf Lehrpersonen, welche noch nie metakognitive
Unterrichtsformen in der Schule eingesetzt haben. Diese Zahlen werden im Diagramm 3 grafisch dargestellt. Auf der
CD-Rom ist zusätzlich ein Diagramm zur Bekanntheit jeder einzelner Unterrichtsformen
unter "Bekannheit und Verbreitung des Konzepts Metakognition" ˆ "Bekanntheit der einzelnen Unterrichtsformen"
ersichtlich.
Den Daten
unserer Erhebung entnehmen wir weiter, dass von den 18 Lehrpersonen, welche
angeben, den Begriff Metakognition nicht zu kennen, dennoch 15 Lehrerinnen und
Lehrer metakognitive Unterrichtsformen anwenden. Die Unterrichtsformen
"Ausführungsmodell" und "Metakognitives Fragen" werden von diesen 15
Lehrerinnen und Lehrern am häufigsten in ihrem Unterricht angewendet.
Nur drei
Lehrpersonen, welche den Begriff Metakognition nicht kennen, setzten auch keine
metakognitiven Unterrichtsformen ein. Von den 85 Lehrpersonen, welche den
Begriff Metakognition schon gehört haben, wenden zwei keine metakognitiven
Unterrichtsformen in der Schule an. Dies ergibt die insgesamt fünf Personen,
welche bis anhin noch nie metakognitive Aspekte in ihrem Unterricht berücksichtigt
haben.
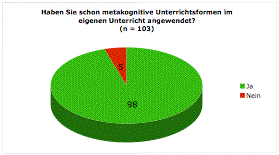
Diagramm 3: Verbreitung des Konzepts Metakognition
6.1.2.2 Interpretation der Daten zu Bekanntheit und Verbreitung des Konzepts
Metakognition
Auf den ersten Blick scheint es, dass der Einsatz von metakognitiven
Unterrichtsformen in der Schule überraschend weit verbreitet ist. Nur fünf der
insgesamt 103 Lehrpersonen, welche an unserer Erhebung teilgenommen haben,
haben in ihrem Unterricht noch nie metakognitive Unterrichtsformen angewendet.
Es gilt jedoch zu beachten, dass wir beim Nachfassen, gezielt
Lehrpersonen gewählt haben, welche an der HfH studieren und daher im Rahmen
ihrer Ausbildung mit dem Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen eher
vertraut sind als Lehrpersonen, welche ausschliesslich eine pädagogische
Grundausbildung absolviert haben. Wir können bei unseren befragten Lehrpersonen
in diesem Punkt also nicht davon ausgehen, dass unsere Daten einem
Durchschnittswert aus der Praxis entsprechen.
Weiter scheint uns eine interessante Feststellung, dass 15 der 103
Lehrpersonen metakognitive Unterrichtsformen anwenden, obwohl sie diesen
Begriff noch nie gehört haben. Lehrpersonen setzen also einzelne metakognitive
Unterrichtsformen in der Schule um, auch wenn sie den Begriff Metakognition
nicht kennen.
Bis jetzt haben wir uns mit den Fragen beschäftigt, ob der Begriff der
Metakognition bekannt ist und ob solche Unterrichtsformen generell eingesetzt
werden. Im Weiteren interessiert uns die Frage, wie häufig die einzelnen
Unterrichtsformen angewendet werden.
6.1.2.3 Zusammenfassung zu Bekanntheit und der Verbreitung des Konzeptes
Metakognition
Unsere
Erhebung zeigt, dass 85 der insgesamt 103 von uns befragten Lehrpersonen den
Begriff "Metakognition" kennen und sogar 98 der 103 Lehrpersonen metakognitive
Unterrichtsformen in der Schule anwenden. Der Begriff "Metakognition" ist den
Lehrpersonen vorwiegend von der Aus- und Weiterbildung her bekannt. Der
Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen scheint in der Schule weit
verbreitet zu sein. Es gilt jedoch zu beachten, dass wir beim Nachfassen
gezielt Lehrpersonen gewählt haben, die an der HfH studieren und daher das
Konzept der Metakognition auf jeden Fall kennen. Unsere Daten widerspiegeln
also kaum die Situation, wie sie im Schulalltag anzutreffen ist.
Lehrpersonen,
welche die Frage, ob sie schon mit metakognitiven Unterrichtsformen gearbeitet
haben, bejahten, wurden anschliessend nach der Häufigkeit der Anwendung der
verschiedenen Unterrichtsformen befragt. In diesem Kapitel werden wir die
Resultate aus dieser Frage präsentieren und unter verschiedenen Aspekten
betrachten.
6.2.1
Herleitung der Indexierung
Um die Häufigkeit
der Anwendung der Unterrichtsformen zu erfragen, haben wir uns entschieden,
fünf Antwortmöglichkeiten anzubieten, wobei nur eine Nennung möglich war. Die
fünf verschiedenen Antwortkategorien waren:
-
täglich
-
2-3 Mal wöchentlich
-
wöchentlich
-
1 Mal im Monat
-
nie
Bei der Auswertung
der Antworten zur Häufigkeit stiessen wir beim Versuch, verschiedene Antwortprofile
zu vergleichen, auf Schwierigkeiten. Das möchten wir anhand eines Beispiels
illustrieren.
Das Diagramm 4 zeigt, wie häufig
die Unterrichtsformen "Arbeitsrückblick" und "Ausführungsmodell" bei den
befragten Lehrpersonen zur Anwendung kommen. Auf der X-Achse stehen die beiden
Unterrichtsformen. Für jede Unterrichtsform wird eine Säule pro
Antwortkategorie angezeigt. Auf der Y-Achse steht die Anzahl Nennungen der
Lehrpersonen. Dieses Diagramm liest sich folgendermassen: 19 der 98
Lehrpersonen zum Beispiel, welche angeben, metakognitive Unterrichtsformen
einzusetzen, wenden den Arbeitsrückblick 2-3 Mal wöchentlich an oder 8 der
befragten Lehrpersonen arbeiten 1 Mal im Monat mit dem Ausführungsmodell.
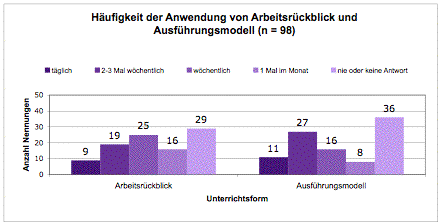
Diagramm 4: Häufigkeit der Anwendung von Arbeitsrückblick und
Ausführungsmodell
Nun stellt sich uns die Frage, auf welche Weise diese Diagramme
miteinander verglichen werden können. Wird jetzt insgesamt der Arbeitsrückblick
oder das Ausführungsmodell häufiger im Unterricht eingesetzt? Wir haben nach
einer Form gesucht, die Anwortkategorien nach der Häufigkeit der Anwendung
einer einzelnen Unterrichtsform zusammen zu fassen, um diese dann einander gegenüberstellen
zu können.
Wir wollten die einzelnen Nennungen jeder Unterrichtsform nicht einfach
zusammen zählen und daraus einen Durchschnittswert berechen, da wir es wichtig
finden, dass zum Beispiel die tägliche Anwendung einer metakognitiven Unterrichtsform
mehr Gewicht erhält als die wöchentliche. Daher haben wir für die Erstellung
eines Diagramms zum Vergleich der Häufigkeiten die Antwortkategorien
unterschiedlich gewichtet. Diese Gewichtung ist in Tabelle
6 ersichtlich. Auf
diese Weise können wir die Nennungen in jeder Kategorie umrechnen und aussagen,
wie viel mal täglich eine Unterrichtsform eingesetzt wird. Dieser
Umrechnungsindex schafft die gleiche Einheit. Somit können wir die verschiedenen
Werte addieren und einen einzelnen Wert berechnen, der nun die Ergebnisse aus
allen Antwortkategorien zusammenfasst. Dies hat den grossen Vorteil, dass sich
nun die Häufigkeit der
Anwendung von einzelnen Unterrichtsformen miteinander
vergleichen lässt.
|
Kategorien zur Häufigkeit |
Gewichtung |
|
täglich |
1 (jeden
Tag) |
|
2-3 Mal wöchentlich |
0.5 (jeden
2. Tag) |
|
wöchentlich |
0.2 (jeden
5. Tag) |
|
1 Mal pro Monat |
0.05 (jeden
20. Tag) |
|
nie oder keine Antwort |
0 |
Tabelle 6: Erklärung
des Umrechnungsindex"
Wir zeigen
nun in Tabelle 7 anhand des Beispieles aus Diagramm 4, wie wir die Kategorien zur
Häufigkeit umrechnen und zu einer Darstellung kommen, in der sich die Resultate
miteinander vergleichen lassen.
Beispiel Arbeitsrückblick:
|
Anzahl Nennungen |
Häufigkeit der Anwendung |
Umrechnung |
|
9 |
täglich (Wert 1) |
9 x 1 = 9 |
|
19 |
2-3 Mal wöchentlich (Wert 0.5) |
19 x 0.5 = 9.5 |
|
25 |
wöchentlich (Wert 0.2) |
25 x 0.2 = 5.0 |
|
16 |
1 Mal pro Monat (Wert 0.05) |
16 x 0.05 = 0.8 |
|
29 |
nie oder keine Antwort (Wert 0) |
29 x 0 = 0 |
Tabelle 7: Umrechnungsbeispiel
Die Summe
der Anzahl Nennungen ist 98 und die Summe aller Werte (9 + 9.5 + 5.0 + 0.8 + 0)
entspricht der Zahl 24.3. Wenn nun die Summe aller Werte durch die Anzahl
Nennungen geteilt wird (24.3 / 98), erhält man den Wert 0.25. Diese Zahl ist
die gemäss unserem Index umgerechnete Häufigkeit der Anwendungen einer
metakognitiven Unterrichtsform bezogen auf eine einzelne Lehrperson. Dieser
Wert liegt zwischen dem Wert 0.5, welcher besagt, dass das Arbeitsheft 2-3 Mal
wöchentlich eingesetzt wird und dem Wert 0.2, was bedeutet, dass das
Arbeitsheft 1 Mal wöchentlich angewendet wird. Das bedeutet, dass die befragten
Lehrpersonen durchschnittlich etwas häufiger als ein Mal pro Woche mit der
metakognitiven Unterrichtsform Arbeitsrückblick arbeiten. Die gleiche Umrechnung ergibt beim
Ausführungsmodell einen Wert von 0.29, was bedeutet, dass das Ausführungsmodell
von den von uns befragten Lehrpersonen häufiger angewendet wird als der
Arbeitsrückblick. Dies lässt sich aus Diagramm 5 herauslesen.
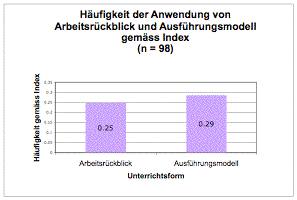
Diagramm 5: Häufigkeit der Anwendung von Arbeitsrückblick und
Ausführungsmodell gemäss Index
Bei den
Diagrammen 6 – 14 sowie 33 – 34 haben wir die Häufigkeit immer mit
dem beschriebenen Index berechnet. Wir sind uns bewusst, dass dies das Ergebnis
unserer Daten verzerrt, doch lassen sich ohne das Schaffen dieser Vergleichswerte
die Daten nicht aufgrund unserer Hypothesen auswerten. Wir sind aber der
Meinung, dass diese Indexierung plausibel, sinnvoll und hilfreich ist, da es
sich eigentlich letztlich nur um eine Umrechnung der Häufigkeitskategorien auf
eine Häufigkeit pro Tag handelt. Der Faktor für diese Umrechnungen lässt sich
dabei aus den Häufigkeitskategorien eindeutig ableiten.
Durch diese Zusammenfassung geht selbstverständlich
die Information darüber verloren, wie sich die Häufigkeit im Bezug auf die
einzelnen Kategorien zusammensetzt. Wir werden deshalb immer wieder auf die
Diagramme mit den noch nicht verrechneten Daten von der Art des Diagramms 4
zurückgreifen, um auf spezielle Verteilungen und Strukturenmuster hinzuweisen.
6.2.2
Häufigkeit der Anwendung der
verschiedenen Unterrichtsformen
Nachdem wir
uns nun mit der Indexierung ein Werkzeug erarbeitet haben, mit dem wir in der
Lage sind, verschiedene Unterrichtsformen in ihrer Häufigkeit zu vergleichen,
wollen wir diese Methode nun auf den Vergleich aller im Fragebogen genannten
Unterrichtsformen anwenden.
6.2.2.1 Analyse der Resultate zur Häufigkeit der Anwendung der metakognitive
Unterrichtsformen
Dabei
wurden die Antworten von allen 98 Personen ausgewertet, welche überhaupt
metakognitive Unterrichtsformen im Unterricht anwenden.
Das Diagramm 6 zeigt, wie häufig welche
Unterrichtsform eingesetzt wird. Auf der X-Achse stehen die einzelnen im
Fragebogen vorgeschlagenen und erklärten Unterrichtsformen. Unter der Rubrik
"Sonstige" ergänzten die befragten Lehrpersonen Reisetagebücher,
Lerntagebücher, Werktagebücher und Sporthefte, die schriftliche Befragung, das
Unterrichtsmittel "Lernen macht Spass" und das kollegiale Feedback. Darunter
versteht die entsprechende Lehrperson kriteriengeleitete Rückmeldungen durch
Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Y-Achse drückt gemäss unserem Index die
Häufigkeit der Anwendung der einzelnen metakognitiven Unterrichtsformen aus.
Das Diagramm
6 zeigt, dass die Unterrichtsform
metakognitives Fragen mit Abstand am meisten, nämlich mehr als zwei Mal
wöchentlich[5] angewendet
wird, gefolgt vom Ausführungsmodell und dem Arbeitsrückblick, die etwas häufiger
als einmal wöchentlich eingesetzt werden. Die Lernpartnerschaft und das
metakognitive Interview werden knapp einmal pro Woche angewendet. Das
Unterrichtsmittel "Ich lerne lernen" und das Arbeitsheft werden lediglich alle
zwei Wochen eingesetzt und die Klassenkonferenz sowie das
Selbstinstruktionstraining gar nur etwas häufiger als 1 Mal im Monat.

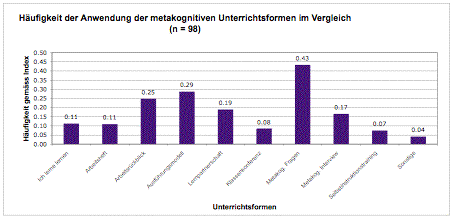
Diagramm 6: Häufigkeit der Anwendung der metakognitiven
Unterrichtsformen im Vergleich
Da das
metakognitive Fragen mit Abstand am häufigsten eingesetzt wird, betrachten wir
nun diese Unterrichtsform in Diagramm 7 genauer. Von den insgesamt 98
Lehrpersonen, welche metakognitive Unterrichtsformen anwenden, setzen 27
Lehrpersonen das metakognitive Fragen täglich ein, 23 Personen 2-3 Mal
wöchentlich, 18 Personen wöchentlich, 8 Personen einmal im Monat und 22
Personen wenden diese Unterrichtsform nicht an oder haben gar keine Antwort
dazu gegeben[6]. Im
Vergleich zu den anderen Unterrichtsformen wird keine täglich so häufig
eingesetzt wie das metakognitive Fragen. Zudem ist sie unter den Lehrpersonen
weit verbreitet, da lediglich 22 von 98 Lehrkräften diese Unterrichtsform noch
nie angewendet haben. Zum Vergleich sind auf der CD-Rom alle Diagramme unter
"Häufigkeit der Anwendung"ˆ "Häufigkeit der Anwendung der
verschiedenen Unterrichtsformen" aufgeführt. 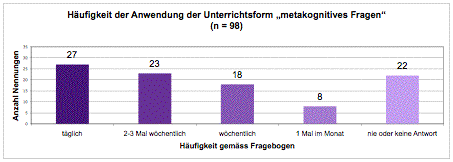
Diagramm 7: Häufigkeit der Anwendung der Unterrichtsform
"metakognitives Fragen"
6.2.2.2 Interpretation zur Häufigkeit der Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen
Wir haben
uns gefragt, warum das metakognitive Fragen im Vergleich zu den anderen
Unterrichtsformen so häufig angewendet wird. Es
könnte daran liegen, dass diese Unterrichtsform mündlich flexibel eingesetzt
werden kann und wenig Zeit kostet. Weiter fällt auf, dass das
Selbstinstruktionstraining und die Klassenkonferenz nur selten angewendet
werden. Das Selbstinstruktionstraining wird von den wenigsten Personen
überhaupt im Unterricht eingesetzt. Wir könnten uns vorstellen, dass es daran
liegt, dass wenige Lehrpersonen diese Unterrichtsform kennen oder sie
vorzugsweise nur in kleinen Gruppen anwenden, da dort mit dem Kind besser
einzeln über seine verwendeten Strategien gesprochen werden kann. Die
Klassenkonferenz wird etwas häufiger als einmal im Monat eingesetzt. Die
seltene Anwendung der Klassenkonferenz macht in unseren Augen aber auch Sinn,
da sich der Austausch von Lernerfahrungen in grösseren Gruppen oder in der
Klasse abnützt, wenn er zu oft stattfindet. Unter den Einträgen in der Rubrik
"Sonstige" fällt auf, dass neun Lehrpersonen noch Reisetagebücher nach
Ruf/Gallin oder andere Lerntagebücher ergänzt haben. Das Arbeiten mit Hilfe von
Lerntagebüchern wollten wir mit dem Arbeitsheft nach Guldimann (1996) erfassen,
haben jedoch durch unsere Erhebung gemerkt, dass den Lehrpersonen der Begriff
des Reisetagebuches nach dem Lehrmittel von Ruf/Gallin (1995) näher liegt. Da
diese Ergänzungen der Lehrkräfte eigentlich noch in die Rubrik "Arbeitsheft"
gehörten, erhöht sich der Wert bei dieser metakognitiven Unterrichtsform somit
geringfügig von 0.11 auf 0.13.
6.2.2.3 Zusammenfassung zur Häufigkeit der Anwendung von metakognitiven
Unterrichtsformen
In
diesem Unterkapitel haben wir eine Indexierung hergeleitet, um die
verschiedenen Unterrichtsformen in ihrer Häufigkeit der Anwendung miteinander
vergleichen zu können. Der Vergleich zeigt, dass das metakognitive Fragen die
mit Abstand am häufigsten eingesetzte Unterrichtsform ist. Wir vermuten, dass
sich dies auf die niederschwellige Anwendung dieser Unterrichtsform zurückführen
lässt. Das Selbstinstruktionstraining und die Klassenkonferenz sind die am
wenigsten häufig eingesetzten Unterrichtsformen. Wir könnten uns vorstellen,
dass das Selbstinstruktionstraining den befragten Lehrpersonen wenig bekannt
ist. Bei der Klassenkonferenz macht es unserer Ansicht nach Sinn, diese nur
knapp monatlich einzusetzen, da sich eine häufige Anwendung dieser Unterrichtsform
mit der Zeit abnützt. Wenn die Einträge zum Thema Lerntagebuch unter der Rubrik
"Sonstige" bei der Unterrichtsform Arbeitsheft eingetragen worden wären, würde
sich dieser Wert etwas nach oben korrigieren, wobei sich an der Reihenfolge
unter den Unterrichtsformen aber nichts änderte.
In diesem
und den folgenden Unterkapiteln werden wir jeweils mit den selben Daten
betreffend Häufigkeit der Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen
arbeiten. Wir werden die Grundgesamtheit der Werte jeweils nach einem
bestimmten Aspekt in Gruppen aufteilen und die Ergebnisse innerhalb der Gruppen
analysieren und Vergleiche zwischen den Gruppen ziehen.
Als ersten
Aspekt haben wir die Klassengrösse der unterrichteten Klasse gewählt. Es steht
damit die Frage im Zentrum, ob und wie sich die Klassengrösse auf die
Häufigkeit der Anwendung der metakognitiven Unterrichtsformen auswirkt.
Wir werden
jeweils zuerst die Daten darstellen, diese interpretieren und anhand der
Hypothesen diskutieren sowie abschliessend zusammenfassen.
6.2.3.1 Analyse der Resultate zum Aspekt Klassengrösse
Für die
Auswertung der Daten zur Häufigkeit der Anwendung von metakognitiven
Unterrichtsformen unter dem Blickwinkel Klassengrösse haben wir nur die Angaben
der insgesamt 69 Regel- und Kleinklassenlehrkräfte verwendet, die metakognitive
Unterrichtsformen einsetzen. Die Anworten der Therapeutinnen und Therapeuten,
der Fachlehrkräfte und der DaZ- und ISF-Lehrpersonen wurden nicht
berücksichtigt, da aus dem Fragebogen nicht ersichtlich wurde, wie gross ihre
einzelnen Unterrichtsgruppen waren. Zudem sind die Daten von 13 Lehrpersonen
für die Auswertung weggefallen, da diese keine oder eine ungültige
Klassengrösse (über 40 oder weniger als 0) angegeben haben. Für die Auswertung
von Diagramm
8 verwenden wir also die Daten von
insgesamt 56 Lehrpersonen. Gemäss unserer Hypothese,
welche besagt, dass metakognitive Unterrichtsformen in Klassen mit weniger als
19 Schülerinnen und Schülern häufiger angewendet werden, fassen wir für die
Auswertung die Daten der Lehrpersonen mit Klassengrössen gleich oder unter 19
Schülerinnen und Schülern (= 26 Personen) und diejenigen Daten von Lehrpersonen
mit Klassengrössen von über 19 Schülerinnen und Schülern (= 30 Personen) zusammen.
Die Y-Achse
in Diagramm
8 beschreibt die Häufigkeit der
Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen gemäss Index und die X-Achse die
verschiedenen von uns im Fragebogen vorgegebenen Unterrichtsformen.
Das Diagramm
8 zeigt, dass sämtliche
Unterrichtsformen in Klassen von ≤19 Schülerinnen und Schülern häufiger
eingesetzt werden als in Klassen mit >19 Schülerinnen und Schülern. Die Unterschiede
bezüglich der Variablen Klassengrösse bei den Unterrichtsformen "Metakognitives
Interview", "Arbeitsrückblick", "Ich lerne lernen" und "Selbstinstruktionstraining"
sind besonders auffallend, während der Unterschied bei der Unterrichtsform
"Klassenkonferenz" minimal ist. Das metakognitive Interview wird in kleinen
Klassen mehr als viermal so häufig angewendet, das Selbstinstruktionstraining
zwölfmal und Ich lerne lernen und der Arbeitsrückblick doppelt so oft.
Auf der
CD-Rom unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ
"Aspekt Klassengrösse" wird für jede einzelne Unterrichtsform ein detailliertes
Diagramm präsentiert.

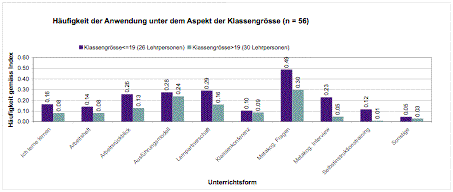
Diagramm 8: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt der
Klassengrösse
6.2.3.2 Interpretation zum Aspekt Klassengrösse
Diagramm 8 zeigt die Tendenz, dass in kleinen
Klassen (²19) häufiger metakognitive Unterrichtsformen eingesetzt werden als in
grossen Klassen (>19).
Dass das
metakognitive Interview und das Selbstinstruktionstraining in kleinen Klassen
bedeutend häufiger angewendet werden als in grossen Klassen, erklären wir uns
folgendermassen: Zum metakognitiven Interview nach Brunsting-Müller (1997)
gehören Fragen, die immer in ähnlicher Weise und in derselben Reihenfolge
gestellt werden, was sich am besten in der Einzelsituation verwirklichen lässt.
Die Einzelsituation lässt sich aber umso schwieriger einrichten, je grösser die
Klasse ist. Ebenso verhält es sich mit dem Selbstinstruktionstraining nach
Meichenbaum und Goodman (1971), welches zumindest bei der Einführungsphase
durch eine Lehrperson individuell begleitet werden muss.
Einzig die
Klassenkonferenz scheint sich für grosse wie für kleine Klassen ebenso zu
eignen. Während sie für kleine Klassen eine der weniger häufig angewendeten
metakognitiven Unterrichtsformen ist, bekommt sie für grosse Klassen einen
deutlich höheren Stellenwert.
6.2.3.3 Diskussion zum Aspekt Klassengrösse
Die
Hypothese zum Aspekt Klassengrösse lautet:
In Klassen
mit bis zu neunzehn Schülerinnen und Schülern werden häufiger metakognitive
Unterrichtsformen eingesetzt als in Klassen mit mehr als neunzehn Schülerinnen
und Schülern.
Mit der
Tatsache, dass sämtliche von uns im Fragebogen aufgeführten Unterrichtsformen
in kleinen Klassen häufiger eingesetzt werden als in grossen Klassen, lässt
sich unsere Hypothese bestätigen. Metakognitive Arbeitsformen verlangen, dass
die Lehrperson Zeit und Kapazität hat, ein Stück weit individuell mit den
Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, was in kleinen Klassen begünstigt wird.
Diese Aussage wird unterstützt von einem weiteren Ergebnis unserer Erhebung zum
Thema Hindernisse beim Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen. 76% der
Lehrpersonen bestätigen nämlich die Behauptung, die Schülerinnen und Schüler
bräuchten beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen viel Unterstützung
durch die Lehrperson. Die Daten dazu werden im Kapitel 6.3.2.1 aufgeführt.
Guldimann
(1996) weist bei seiner Beschreibung der Instrumente zur Förderung der
Entwicklung von metakognitiven Strategien explizit darauf hin, dass deren
Anwendung im Rahmen des regulären Unterrichtes möglich sein muss. Wir denken,
er ist sich der Tatsache bewusst, dass metakogntive Unterrichtsformen
vorwiegend in kleinen Unterrichtsgruppen oder in der Einzelsituation angewendet
werden und hat bewusst Unterrichtsformen entwickelt, die diese Tendenz
aufbrechen könnten.
Im Weiteren
gilt es zu beachten, dass die Resultate unter dem Aspekt der Klassengrösse
durch eine weitere Variable beeinflusst werden: Der Aspekt des
Tätigkeitsfeldes. Ob eine Lehrkraft also im heilpädagogischen Umfeld oder an
einer Regelklasse tätig ist, spielt auch in den Aspekt Klassengrösse hinein.
Mehr als 50% der 26 Lehrpersonen, die eine Klassengrösse von 19 Kindern und
weniger haben, sind im heilpädagogischen Umfeld tätig. Ausnahmslos alle Kleinklassenlehrkräfte
gehören in die Gruppe der "kleinen" Klassen. Das belegt, dass die beiden
Variablen "Klassengrösse" und "Tätigkeitsfeld" nicht unabhängig voneinander
sind.
Dies stellt
die präsentierten Resultate nicht in Frage, sie müssen aber im Zusammenhang mit
den Ergebnissen aus dem folgenden Kapitel betrachtet werden, wo die Häufigkeiten
unter dem Aspekt Tätigkeitsfeld betrachtet werden.
6.2.3.4 Zusammenfassung zum Aspekt Klassengrösse
Bezüglich des Aspekts Klassengrösse
zeigt sich die Tendenz, dass in Klassen mit bis zu 19 Schülerinnen und Schülern
häufiger metakognitive Unterrichtsformen eingesetzt werden als in grossen
Klassen mit mehr als 19 Schülerinnen und Schüler. Die Differenzen zwischen den
beiden Vergleichsgruppen sind beim metakognitiven Interview und beim
Selbstinstruktionstraining beachtlich. Dies lässt sich allenfalls darauf zurückführen,
dass beide Unterrichtsformen eine speziell grosse individuelle Unterstützung
durch die Lehrperson verlangen, was in kleinen Klassen begünstigt wird.
Es gilt zu beachten, dass die
Resultate unter dem Aspekt der Klassengrösse durch eine weitere Variable
beeinflusst werden: Die Variable "Tätigkeitsfeld". Mehr als 50% der 26 Lehrpersonen,
die eine Klassengrösse von 19 Kindern und weniger haben, sind nämlich im
heilpädagogischen Umfeld tätig.
6.2.4
Aspekt Tätigkeitsgebiet einer
Lehrperson
Als
nächster Aspekt folgt die Unterteilung nach dem Tätigkeitsgebiet der
Lehrperson. Nun geht es um die Frage, wie es sich auf die Häufigkeit der
Anwendung der metakognitiven Unterrichtsformen auswirkt, ob eine Lehrperson im
heilpädagogischen oder im Regelklassenumfeld tätig ist.
6.2.4.1 Analyse der Resultate zum Aspekt Tätigkeitsgebiet einer Lehrperson
Beim Diagramm 9 verwenden wir grundsätzlich die
Daten derjenigen Lehrpersonen, die in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig
sind, das heisst, als Kleinklassen-, ISF-Lehrpersonen oder Therapeutinnen und
Therapeuten arbeiten sowie der Regelklassenlehrkräfte. Die Daten von 25
Lehrkräften fallen weg, da diese als Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder im DaZ-
Bereich unterrichten oder keine Angaben zu ihrem Tätigkeitsgebiet gemacht haben
(14), in einer Regelklasse und zugleich in einem ISF-Modell oder einer Kleinklasse
unterrichten[7] (6) oder
metakognitive Unterrichtsformen generell nicht anwenden (5). Insgesamt werden
also die Daten von 78 befragten Lehrpersonen ausgewertet, 39
Regelklassenlehrpersonen und 39 Lehrerinnen und Lehrer, welche in einem
heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig sind. Die Y-Achse bildet die Häufigkeit der
Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen gemäss unserem Index und die
X-Achse listet die verschiedenen Unterrichtsformen auf.
Aus dem Diagramm 9 wird ersichtlich, dass die
Unterrichtsformen "Arbeitsrückblick", "Ausführungsmodell", "Lernpartnerschaft",
"Metakognitives Fragen", "Metakognitives Interview" und "Selbstinstruktionstraining"
häufiger von Lehrkräften angewendet werden, welche in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld
tätig sind, als von Regelklassenlehrkräften. Die Unterrichtsform
"metakognitives Interview" wird im heilpädagogischen Tätigkeitsgebiet sogar siebenmal
und das Selbstinstruktionstraining dreimal so häufig eingesetzt wie im
Regelklassenumfeld. Im Gegensatz dazu werden die Unterrichtsformen "Ich lerne
lernen", "Arbeitsheft" und "Klassenkonferenz" minim häufiger von Lehrpersonen
eingesetzt, welche Regelklassen unterrichten.

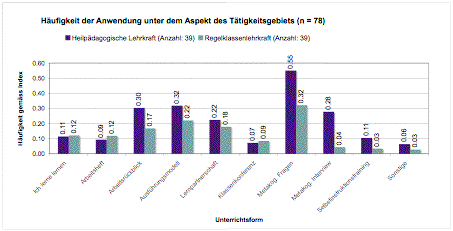
Diagramm 9: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt des
Tätigkeitsgebiets
Um diesen
grossen Unterschied beim Einsatz der Unterrichtsform "Metakognitives Interview"
zwischen dem heilpädagogischen Arbeitsbereich und dem Regelklassenumfeld
genauer betrachten zu können, fügen wir das Diagramm 10 mit der detaillierten Aufstellung
der Anworten an. Die Y-Achse zeigt die Anzahl der Nennungen in Prozent und die
X-Achse enthält die beiden für uns relevanten Tätigkeitsgebiete. Die Häufigkeit
der Anwendung derjenigen Lehrpersonen, die im heilpädagogischen Bereich
arbeiten, beträgt zwischen 13 und 23% für alle Kategorien, bei denen die
Unterrichtsform tatsächlich angewendet wird. Auffallend ist, dass lediglich 26%
dieser Lehrpersonen das metakognitive Interview nicht anwenden oder gar keine
Antwort gegeben haben im Vergleich zu den knapp 80% Lehrpersonen des
Regelklassenumfeldes, welche das metakognitive Fragen nicht einsetzen. Die Anwendung
der Lehrpersonen des Regelklassenumfeldes liegt in allen Häufigkeitskategorien
unter 10%. Auf der CD-Rom sind die präzisen Diagramme zu den restlichen Unterrichtsformen
unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ "Aspekt Tätigkeitsgebiet"
einzusehen.
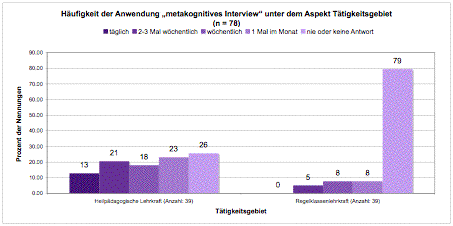
Diagramm 10: Häufigkeit der Anwendung "metakognitives Interview" unter dem Aspekt
Tätigkeitsgebiet
6.2.4.2 Interpretation zum Aspekt Tätigkeitsgebiet einer Lehrperson
Das Diagramm 9 zeigt unserer Ansicht nach, dass Lehrkräfte,
welche im heilpädagogischen Tätigkeitsbereich arbeiten, mehrheitlich häufiger metakognitive Unterrichtsformen einsetzen als
Regelklassenlehrkräfte. Wir denken, es liegt daran, dass Lehrpersonen, welche
in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig sind, im Rahmen ihrer
Zusatzausbildung verschiedene metakognitive Unterrichtsformen kennengelernt und
ausprobiert haben. Die Beobachtung, dass das metakognitive Interview im
heilpädagogischen Arbeitsfeld siebenmal so oft eingesetzt wird wie im
Regelklassenumfeld lässt sich damit begründen, dass gerade für Kinder, welche
einen speziellen Förderbedarf aufweisen, Unterrichtsformen von Bedeutung sind,
welche den individuellen Lernstand berücksichtigen und das bestehende Wissen
ernst nehmen. Dies lässt sich zum Beispiel mit der Unterrichtsform "Metakognitives
Interview" erreichen.
6.2.4.3 Diskussion zum Aspekt Tätigkeitsgebiet einer Lehrperson
Die
Hypothese zur Variablen "Tätigkeitsgebiet" lautet:
Eine
Lehrkraft, welche im Rahmen der Volksschule in einem heilpädagogischen
Arbeitsfeld tätig ist, setzt häufiger metakognitive Unterrichtsformen ein.
Die
Ergebnisse aus Diagramm
9 bestätigen grundsätzlich diese Hypothese. Wenige
Unterrichtsformen weichen nur unwesentlich von dieser Aussage ab. Beim
Selbstinstruktionstraining und beim metakognitiven Interview zeigen sich bei
beiden Variablen die grössten Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen.
Mackowiak
(2004) schreibt, dass die Vermittlung von Lernstrategien besonders angezeigt
ist bei Schülerinnen und Schülern, die ihre intellektuellen Fähigkeiten nicht
adäquat in schulische Leistungen umsetzen können. Wenn man davon ausgeht, dass
die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, die eine ISF oder eine Kleinklasse
besuchen, nach Jegge (1991) nicht an ihrer genetischen Begabungsschranke
anstösst sondern an soziokulturellen und psychischen Beschränkungen, ist es
gerade im heilpädagogischen Bereich von grosser Wichtigkeit, dass sich die
Schülerinnen und Schüler den metakognitiven Aspekt des Lernens zu Nutze machen
können. Daher ist es unserer Ansicht nach ein sehr erfreuliches Ergebnis, dass
Lehrpersonen, welche in einem heilpädagogischen Tätigkeitsgebiet arbeiten,
vermehrt darauf achten, metakognitive Unterrichtsformen einzusetzen.
Auch hier gilt es wieder zu beachten, dass die Häufigkeit
der Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen unter dem Aspekt
Tätigkeitsgebiet von der Variablen Klassengrösse beeinflusst wird, da
Lehrpersonen, welche in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig sind, tendenziell
auch mit kleineren Kindergruppen arbeiten.
6.2.4.4 Zusammenfassung zum Aspekt Tätigkeitsgebiet einer Lehrperson
Unsere Erhebung zeigt, dass
Lehrpersonen, welche in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig sind,
häufiger Unterrichtsformen anwenden, die den metakognitiven Aspekt des Lernens
berücksichtigen, als Regelklassenlehrkräfte, was unsere Hypothese grundsätzlich
bestätigt. Dies könnte daran liegen, dass Lehrpersonen, welche in einem heilpädagogischen
Arbeitsfeld tätig sind, üblicherweise auch eine weiterführende Ausbildung
absolviert haben, in welcher sie solche Unterrichtsformen kennen gelernt haben.
Die Beobachtung, dass das
metakognitive Interview im heilpädagogischen Arbeitsfeld siebenmal so oft
eingesetzt wird wie im Regelklassenumfeld lässt sich damit begründen, dass
gerade für Kinder, welche einen speziellen Förderbedarf aufweisen, Unterrichtsformen
von Bedeutung sind, welche den individuellen Lernstand berücksichtigen, was
sich zum Beispiel mit der Unterrichtsform "Metakognitives Interview" erreichen
lässt.
Es ist erfreulich, dass
Lehrpersonen, die in einem heilpädagogischen Bereich arbeiten, speziell den
Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen berücksichtigen. Nach Jegge (1991)
stossen nämlich die meisten Kinder mit Lern- oder Leistungsschwierigkeiten
nicht an ihrer genetischen Begabungsschranke sondern an soziokulturellen und psychischen
Beschränkungen an. Daher ist es gerade im heilpädagogischen Bereich von grosser
Wichtigkeit, dass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe metakognitiver
Strategien lernen, ihre intellektuellen Fähigkeiten adäquat in schulische
Leistungen umzusetzen.
6.2.5
Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch als
Zweitsprache
In diesem
Kapitel gehen wir der Frage nach, ob der Anteil von Schülerinnen und Schülern
mit Deutsch als Zweitsprache in einer Klasse einen Einfluss auf den Einsatz von
metakognitiven Unterrichtsformen hat.
6.2.5.1 Analyse der Resultate zum Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch als
Zweitsprache
Für die
Auswertung der Daten in Diagramm 11 haben wir die Antworten von
insgesamt 78 Lehrpersonen verwendet, von 51 Lehrerinnen und Lehrern mit einer
Unterrichtsgruppe von einem DaZ-Anteil unter 40% und von 27 Lehrerinnen und
Lehrern mit Klassen von einem DaZ-Anteil über 40%. Die Angabe von 25 Personen
konnten nicht ausgewertet werden, da diese gar keine metakognitiven Unterrichtsformen
einsetzen (5), keine Klassengrössen oder keine bzw. eine ungültige Anzahl
DaZ-Kinder angegeben haben (20).
Die Y-Achse
enthält die Häufigkeit gemäss unserem Index und die X-Achse alle im Fragebogen
aufgeführten metakognitiven Unterrichtsformen. Das Diagramm zeigt, dass mit
Ausnahme der Unterrichtsformen "Arbeitsrückblick" und "Klassenkonferenz" alle
Unterrichtsformen von Unterrichtsklassen und -gruppen mit einem Anteil von
Kindern mit DaZ von über 40% häufiger eingesetzt werden. Mit Ausnahme des metakognitiven
Fragens zeigen sich jedoch keine grossen Unterschiede.
Auf der
CD-Rom sind unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ
"Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch als Zweitsprache" zusätzlich die
Diagrammdaten der einzelnen Unterrichtsformen bezogen auf Lehrpersonen
von Regelklassen wie auch auf Lehrpersonen aus dem heilpädagogischen Umfeld
ersichtlich.
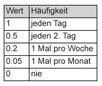
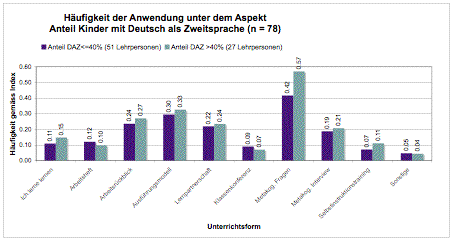
Diagramm 11: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch
als Zweitsprache
Da die
Unterschiede eher gering ausfallen und unsere Erhebung einen hohen Anteil an
Lehrpersonen enthält, welche in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig sind,
mit Unterrichtsgruppen arbeiten, die einen prozentual hohen Anteil an
DaZ-Kindern aufweisen[8]
und – wie wir bereits gesehen haben – vermehrt metakognitive
Unterrichtsformen einsetzen, fügen wir noch Diagramm 12 an. Diagramm 12 beschreibt ebenfalls die Häufigkeit
der Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen unter dem Blickwinkel des
Anteils Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache, berücksichtigt
jedoch nur die Daten der Regelklassenlehrpersonen. Für dieses Diagramm wurden
die Daten von allen 54 Regelklassenlehrkräften verwendet. Davon ausgeschlossen
sind Lehrpersonen, die eine Regelklasse unterrichten und gleichzeitig an einer
ISF oder Kleinklasse tätig sind (6), die keine metakognitiven Unterrichtsformen
anwenden (5) oder die keine Angaben zur Klassengrösse oder zur Anzahl Kinder
mit Deutsch als Zweitsprache gemacht haben (6). Wir werten die Daten von 37
Lehrpersonen aus, wobei wir anmerken müssen, dass die 10 Lehrpersonen bei einem
DaZ-Anteil von unter 40% nicht mehr als statistisch relevant angesehen werden
können.
Die Y-Achse
drückt wiederum die Häufigkeit gemäss unserem Index aus und die X-Achse die verschiedenen
Unterrichtsformen. Auch aus diesem Diagramm geht hervor, dass Klassen mit über
40% DaZ-Kindern mit Ausnahme der Rubrik "Sonstige", "Metakognitives Interview"
und "Klassenkonferenz" häufiger metakognitive Unterrichtsformen einsetzen. Die
Unterrichtsformen "Ausführungsmodell" und "Klassenkonferenz" weisen jedoch
keinen deutlichen Unterschied auf.

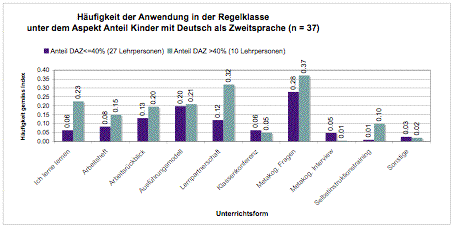
Diagramm 12: Häufigkeit der Anwendung in der Regelklasse unter dem Aspekt Anteil
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache
Auf der
CD-Rom unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ
"Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch als Zweitsprache" ist ein weiteres Diagramm
ersichtlich, welches nur die Daten der Lehrpersonen aus dem heilpädagogischen
Umfeld berücksichtigt. Des Weiteren sind am selben Ort die Diagrammdaten
bezogen auf jede einzelne Unterrichtsform einsehbar.
6.2.5.2 Interpretation zum Aspekt Deutsch als Zweitsprache
Insgesamt
zeigt Diagramm
11, dass metakognitive
Unterrichtsformen in Klassen mit über 40% DaZ-Kindern generell häufiger
eingesetzt werden. Diese Tendenz wird von Diagramm 12 noch klarer bestätigt, obwohl dort
zu berücksichtigen ist, dass die eine Gruppe der befragten Lehrpersonen nicht repräsentativ
ist, da sie nur aus 10 Personen besteht.
Problematisch ist das Verwischen der Ergebnisse bei
Lehrpersonen, die an mehreren Klassen oder Gruppen unterrichten, da es hier
unmöglich ist, die Anworten den einzelnen Gruppen zuzuordnen. Falls die Klassen
oder Gruppen bezüglich des Anteils Kinder mit Deutsch als Zweitsprache stark
variieren, könnte sich hieraus eine Unschärfe ergeben.
6.2.5.3 Diskussion zum Aspekt Deutsch als Zweitsprache
Auf die
Frage nach dem Einfluss der Zweitsprachigkeit auf die Häufigkeit der Anwendung
von metakognitiven Unterrichtsformen, sind wir von folgender Hypothese
ausgegangen:
In Klassen
mit einem Anteil an Kindern mit Deutsch als Zweitsprache von 40% oder mehr werden kaum noch metakognitive
Unterrichtsformen eingesetzt.
Die
Ergebnisse aus diesem Kapitel widerlegen unsere Hypothese und überraschen uns.
Obwohl Kinder mit Deutsch als Zweitsprache beim mündlichen und schriftlichen
Formulieren ihrer Lernerfahrungen stärker herausgefordert sind als Kinder mit
deutscher Muttersprache, werden in Klassen mit einem hohen Anteil von
DaZ-Kindern häufiger metakognitive Unterrichtsformen eingesetzt.
Wir
erklären uns dieses Ergebnis folgendermassen: Schulen mit Klassen, die einen hohen
Anteil von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache aufweisen, müssen
gezwungenermassen auf eine grosse Heterogenität in der Klasse reagieren. Viele
der metakognitiven Unterrichtsformen können auch eingesetzt werden, um den
Unterricht zu individualisieren. Wir denken da zum Beispiel an das Arbeitsheft
oder an das metakognitive Fragen, zwei Unterrichtsformen, die den individuellen
Lernstand eines Kindes berücksichtigen und es ihm ermöglichen, neues an bereits
bestehendes Wissen anzuknüpfen. Rüesch (1999) schreibt auf die Frage nach
effektivem Unterricht für Kinder aus Immigrantenfamilien, dass ein
erfolgreiches Förderprogramm zusätzlich zur Verwirklichung des Konzeptes der
direkten Instruktion[9]
möglichst optimal an die individuellen Lernbedürfnisse angepasst sein muss.
Einige
Unterrichtsformen wie zum Beispiel die Lernpartnerschaft oder die
Klassenkonferenz fördern die Zusammenarbeit und das Verständnis der Kinder
untereinander, was dem Unterricht in einem multikulturellen Umfeld ebenfalls
Rechnung trägt.
6.2.5.4 Zusammenfassung zum Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch als
Zweitsprache
In
Klassen und Unterrichtsgruppen mit einem DaZ-Anteil von über 40% werden
entgegen unserer Hypothese die im Fragebogen vorgegebenen metakognitiven
Unterrichtsformen –mit zwei Ausnahmen– häufiger angewendet. Wir
stellen uns vor, dass Schulen mit Klassen, die einen hohen Anteil von Kindern
mit Deutsch als Zweitsprache aufweisen, auf die grosse Heterogenität in der
Klasse reagieren müssen. Da bieten sich die metakognitiven Arbeitsformen auch
an, um individualisierend zu unterrichten.
In diesem
Kapitel gehen wir der Frage nach, ob das Schulalter der Kinder einen Einfluss
auf den Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen hat.
6.2.6.1 Analyse der Resultate zum Aspekt Schulalter
Eigentlich
wollten wir hier die Daten nach Klassen auswerten, um den Verlauf des Einsatzes
von metakognitiven Unterrichtsformen über die neun Schuljahre hinweg beobachten
zu können. Wir stiessen jedoch auf das Problem, dass nur 56 der 103 befragten
Lehrkräfte ausschliesslich an Klassen des gleichen Schuljahrs unterrichten. Die
anderen Lehrpersonen arbeiten alle an mehreren Klassen oder unterrichten zwei
und mehr Klassen gleichzeitig. Bei solchen Lehrpersonen konnten wir aus unserem
Fragebogen heraus nicht mehr eruieren, auf welches Schulalter sich ihre
Antworten beziehen. Die Daten der 56 Lehrpersonen, welche nur an einer Klasse
unterrichten, aufgeteilt auf die neun Schuljahre, ergibt, wie Tabelle 8 zeigt, zu wenige Lehrpersonen pro Klasse, als dass
damit aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden könnten.
Schulalter |
Anzahl Lehrpersonen |
|
Schulalter |
Anzahl Lehrpersonen |
|
1. Klasse |
13 |
|
6. Klasse |
6 |
|
2. Klasse |
8 |
|
7. Klasse |
3 |
|
3. Klasse |
6 |
|
8. Klasse |
2 |
|
4. Klasse |
9 |
|
9. Klasse |
1 |
|
5. Klasse |
8 |
|
|
|
Tabelle 8: Anzahl Lehrpersonen pro
Klasse, die jeweils nur ein Schulalter unterrichten
Daher haben
wir uns entschieden, die Antworten der Lehrkräfte stufenbezogen auszuwerten.
Für die Auswertung der Daten, wie es Diagramm 13 zeigt, haben wir die Antworten
aller 103 Lehrpersonen verwendet, unter der Bedingung, dass diese lediglich an
einer Stufe unterrichten. Weggefallen sind daher die Daten von Lehrpersonen,
die stufenübergreifend arbeiten (25), die keine Klassenangaben gemacht (3) und
die noch nie metakognitive Unterrichtsformen eingesetzt haben (5). Insgesamt
haben wir also die Angaben von 70 Lehrpersonen verwendet. 31 Personen arbeiten
ausschliesslich an der Unterstufe, 27 an der Mittelstufe und 12 an der
Oberstufe.
Die Y-Achse
von Diagramm
13 zeigt die Häufigkeit der Anwendung
metakognitiver Unterrichtsformen gemäss unserem Index und die X-Achse enthält
die verschiedenen Unterrichtsformen. Das Diagramm zeigt auf, dass an der
Oberstufe bei allen von uns im Fragebogen vorgegebenen metakognitiven
Unterrichtsformen der Einsatz am häufigsten ist. Der Vergleich zwischen der
Unter- und der Mittelstufe fällt folgendermassen aus: Bei den Unterrichtsformen
"Ich lerne lernen", "Arbeitsheft", "Arbeitsrückblick" und "Klassenkonferenz"
sind die Unterschiede bezüglich der Häufigkeit des Einsatzes unbedeutend. Das
Ausführungsmodell, das metakognitive Fragen, das metakognitive Interview und
das Selbstinstruktionstraining werden an der Unterstufe häufiger eingesetzt.
Einzig die Lernpartnerschaft wird in der Mittelstufe öfter angewendet als in
der Unterstufe.
Den
Diagrammen 13 und 14 liegen wiederum Auswertungen bezogen auf die einzelnen Unterrichtsformen zugrunde, die
auf der CD-Rom unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ
"Aspekt Schulstufe" ˆ "Diagrammdaten bezogen auf
Schulstufen" ersichtlich sind.
Zudem befinden sich unter dem selben Aspekt bei ˆ
"Diagrammdaten bezogen auf Klassen" Diagramme, die die Häufigkeit des Einsatzes
nach Klassen aufgliedert.

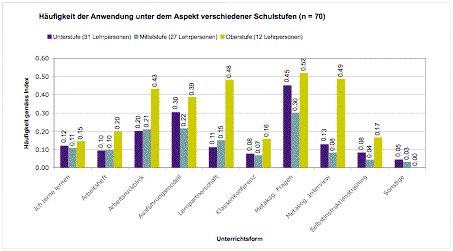
Diagramm 13: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt verschiedener Schulstufen
(1)
In Diagramm 14 werden die gleichen Werte auf eine
andere Art grafisch dargestellt, um ein noch aussagekräftigeres Bild zu
erhalten. Die Y-Achse enthält die Häufigkeit des Einsatzes gemäss unserem Index
und die X-Achse die einzelnen Schulstufen. Im Diagramm 14 ist ebenfalls deutlich ersichtlich,
dass der Wert bezüglich des Einsatzes metakognitiver Unterrichtsformen an der
Oberstufe generell über demjenigen der Mittel- sowie der Unterstufe liegt. In
dieser Darstellungsform ist zudem ein Knick nach unten in der Häufigkeit
während der Mittelstufe erkennbar. Mit Ausnahme der Lernpartnerschaft erhöht
sich der Einsatz metakognitiver Arbeitsformen von der Unter- in die Mittelstufe
nicht, er stagniert oder geht deutlich nach unten.
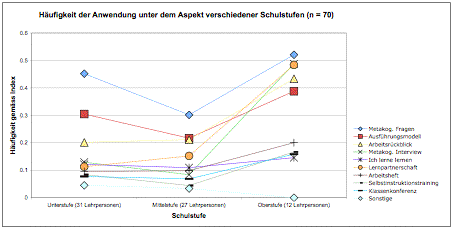
 Diagramm 14: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt verschiedener Schulstufen
(2)
Diagramm 14: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt verschiedener Schulstufen
(2)
6.2.6.2 Interpretation zum Aspekt Schulalter
Es zeigt
sich eine steigende Grundtendenz bezüglich der Häufigkeit der Anwendung von
metakognitiven Unterrichtsformen. Diese Tendenz wird jedoch von den Werten
bezüglich der Häufigkeit an der Mittelstufe deutlich unterbrochen. Im Vergleich
zur Unterstufe bleibt der Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen in der
Mittelstufe konstant oder geht klar zurück. An der Oberstufe nimmt im Vergleich
zur Mittelstufe die Häufigkeit des Einsatzes metakognitiver Elemente bei allen
aufgeführten Unterrichtsformen deutlich zu. Allerdings müssen wir anmerken,
dass die Ergebnisse der Oberstufe aufgrund der kleinen Anzahl Antworten von
Oberstufenlehrpersonen mit Vorsicht zu interpretieren sind.
6.2.6.3 Diskussion zum Aspekt Schulalter
Auf die
Frage nach dem Einfluss des Aspektes Schulalter auf die Häufigkeit der
Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen, sind wir von folgender
Hypothese ausgegangen:
Mit zunehmendem Alter der Schülerinnen und
Schüler werden häufiger metakognitive Unterrichtsformen eingesetzt.
Zum einen
lässt sich unsere Hypothese bestätigen. Es ist ein Zuwachs am Einsatz
metakognitiver Unterrichtsformen bezüglich des Schulalters beobachtbar. In der
Oberstufe wird nämlich eindeutig am häufigsten metakognitives Lernen angeregt.
Diese Tendenz weist aber in der Mittelstufe einen grossen Knick auf. Von der
Entwicklung des Kindes her ist diese Abnahme des Einsatzes metakognitiver
Unterrichtsformen nicht nachvollziehbar. Wir finden es sehr schade, dass der
grosse Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe im
fachlichen Bereich nicht einhergeht mit der Entwicklung metakognitiver
Kompetenzen, da die Schülerinnen und Schüler diesbezüglich im Unterricht wenig
Anregungen bekommen. Wir haben nach Erklärungen für dieses Ergebnis gesucht und
könnten uns vorstellen, dass Mittelstufenlehrpersonen wegen des †bertrittes in
der sechsten Klasse unter grossem Stoffdruck stehen und daher aus Zeitgründen
weniger metakognitive Unterrichtsformen einsetzen. Diese Vermutung wird dadurch
bestärkt, dass 73% der Lehrpersonen in unserer Erhebung den grossen Zeitaufwand
beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen als Hindernis bestätigen. Die
Ergebnisse dazu sind in Kapitel 6.3.2.1 ersichtlich.
Bezüglich
der grossen Häufigkeit der Anwendung in der Oberstufe muss allerdings berücksichtigt
werden, dass lediglich drei der zwölf Oberstufenlehrpersonen ausschliesslich
eine Regelklasse unterrichten. Die anderen Lehrpersonen arbeiten in einem
heilpädagogischen Umfeld, in welchem – wie wir bereits gesehen haben
– häufiger metakognitive Unterrichtsformen angewendet werden.
6.2.6.4 Zusammenfassung zum Aspekt Schulalter
Mit
zunehmendem Alter werden grundsätzlich häufiger metakognitive Unterrichtsformen
eingesetzt. Diese Tendenz weist aber in der Mittelstufe einen grossen Knick
auf. Von der Entwicklung des Kindes her ist diese Abnahme des Einsatzes
metakognitiver Unterrichtsformen nicht nachvollziehbar. Wir erklären uns dies
damit, dass Mittelstufenlehrpersonen wegen des †bertritts in die Oberstufe
unter grossem Stoffdruck stehen und ihnen daher die Zeit fehlt, metakognitive
Aspekte im Unterricht ausgiebig zu thematisieren.
6.3
Beurteilung der Wirksamkeit
Wir haben
mit unserer Erhebung auch Antworten gesucht auf die Frage, wie Lehrkräfte den
Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen erleben, wie sie deren Nutzen
einschätzen und welche Erfahrungen sie dabei machen. Zudem suchen wir Antworten
zur Einschätzung der Lehrpersonen bezüglich der Hindernisse beim Einsatz von
metakognitiven Unterrichtsformen.
Wir werden
wiederum jeweils zuerst die Daten darstellen, diese interpretieren und aufgrund
der Hypothesen diskutieren. Zum Schluss folgt eine kurze Zusammenfassung zu den
entsprechenden Resultaten.
6.3.1
Erfahrungen mit der Anwendung von
metakognitiven Unterrichtsformen
Wir gehen
nun der Frage nach, wie sich die Lehrpersonen zu den Aussagen stellen, die Anwendung
von metakognitiven Unterrichtsformen wirke sich positiv auf die Entwicklung
verschiedener Fertigkeiten aus.
6.3.1.1 Analyse der Resultate zu den Erfahrungen
Für die
Auswertung der folgenden Diagramme haben wir die Daten von 98 Lehrpersonen verwendet.
Die Daten der fünf Personen, welche noch nie metakognitive Unterrichtsformen
angewendet haben, konnten nicht berücksichtigt werden. Unter der Rubrik
"Sonstige" wurden von den Lehrpersonen noch diverse interessante €usserungen
bezüglich weiterer Fertigkeiten gemacht, welche ihrer Meinung nach durch die
Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen gefördert werden. Die Lehrpersonen
haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler
durch den Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen selbstsicherer werden, ihr
negatives Selbstbild verbessern können, ihre Sprachkompetenzen erweitern, ein
Interesse entwickeln, sich neues Wissen anzueignen und dass sie lernen, mitzudenken
und bei allfälligen Problemen Verantwortung zu übernehmen sowie mithelfen, nach
Lösungen zu suchen.
Die nun
folgenden acht Kreisdiagramme zeigen, wie die von uns befragten Lehrpersonen zu
unseren "Thesen" bezüglich der positiven Entwicklung verschiedener Fertigkeiten
stehen. Bei der Darstellung der Diagramme haben wir dieselbe Reihenfolge
gewählt, wie bei der Auflistung der Fertigkeiten im Fragebogen. Ebenso haben
wir darauf geachtet, immer die gleichen Farben für Zustimmung und Ablehnung zu
wählen.
Diagramm
15 zeigt, dass 91% der befragen
Lehrkräfte der Behauptung, dass die Anwendung von metakognitiven
Unterrichtsformen den Schülerinnen und Schülern dazu verhilft, selbständiger zu
lernen, entweder voll und ganz oder zumindest eher zustimmen. Lediglich 4%
sagen, dass dies eher nicht stimme. Keine der befragten Lehrpersonen ist der
Meinung, dass diese Aussage gar nicht stimme. 5% geben an, diesbezüglich noch
keine Erfahrung gemacht zu haben, oder haben keine Antwort abgegeben.
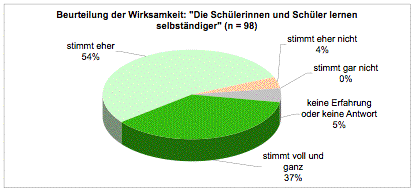
Diagramm 15: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler lernen
selbständiger"
Diagramm
16 zeigt, dass 84% der von uns
befragten Lehrpersonen der Meinung sind, dass die Schülerinnen und Schüler
durch die Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen ihre eigenen Stärken und
Schwächen kennen. 8% verneinen dies und 8% haben diesbezüglich keine Erfahrung
gemacht oder keine Antwort gegeben.
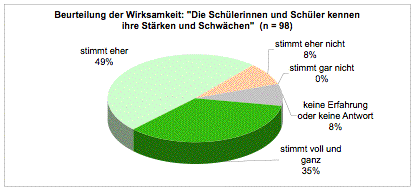
Diagramm 16: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler kennen
ihre Stärken und Schwächen"
Diagramm
17 zeigt, dass 89% der Lehrpersonen
der Aussage die Schülerinnen und Schüler kennen eigene Lernstrategien entweder
voll und ganz oder zumindest eher zustimmen. 5% verneinen diese Aussage und 6%
haben diesbezüglich keine Erfahrung gemacht oder keine Antwort gegeben.
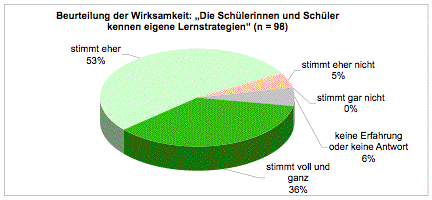
Diagramm 17: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler kennen
eigene Lernstrategien"
Diagramm
18 zeigt, dass 71% der Lehrpersonen
der Meinung sind, dass die Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz
metakognitiver Unterrichtsformen lernen, ihre Lernstrategien bewusst einzusetzen.
18% stimmen dieser Aussage entweder eher nicht oder gar nicht zu und 11% haben
diesbezüglich noch keine Erfahrungen gemacht oder keine Antwort abgegeben. Bei
dieser Aussage tritt nun auch zum ersten Mal ein Teil der befragten Lehrkräfte
dafür ein, dass diese These gar nicht stimmt.
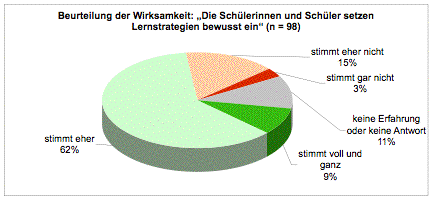
Diagramm 18: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler setzen
Lernstrategien bewusst ein"
Diagramm
19 zeigt, dass 63% der Lehrpersonen
bestätigen, dass die Schülerinnen und Schüler durch die Anwendung
metakognitiver Unterrichtsformen ihre Arbeiten selbständig planen lernen. 24%
verneinen dies und 13% haben damit keine Erfahrung gemacht oder keine Antwort
angegeben.
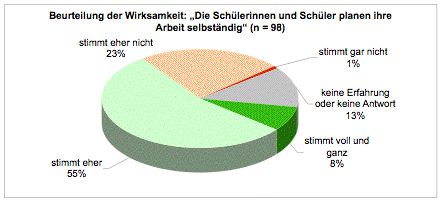
Diagramm 19: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler planen
ihre
Arbeit selbständig"
Aus Diagramm 20 wird ersichtlich, dass 66% der von
uns befragten Lehrpersonen der Ansicht sind, dass die Schülerinnen und Schüler
lernen, das Ergebnis ihrer Arbeit realistisch einzuschätzen. 25% stimmen dieser
Aussage nicht zu und 9% haben diesbezüglich keine Erfahrung gemacht oder keine
Antwort angegeben.
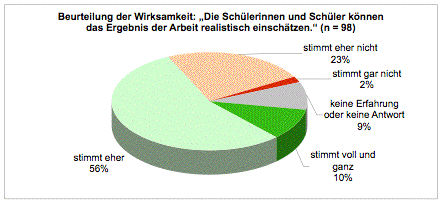
Diagramm 20: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler können
das Ergebnis der Arbeit realistisch einschätzen"
Diagramm
21 zeigt auf, dass 74% der
Lehrpersonen der Meinung sind, dass die Schülerinnen und Schüler durch den
Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen wissen, wo sie sich relevante
Informationen und Hilfsmittel beschaffen können. 18% verneinen dies und 8%
haben diesbezüglich noch keine Erfahrungen gemacht oder keine Antwort
abgegeben.
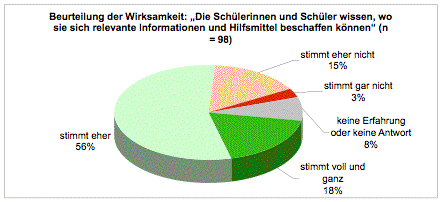
Diagramm 21: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler wissen,
wo sie sich relevante Informationen und Hilfsmittel beschaffen können"
Diagramm
22 zeigt, dass 73% der Lehrpersonen
der Ansicht sind, dass die Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz metakognitiver
Unterrichtsformen teamfähiger werden. 14% stimmen dieser Aussage nicht zu und
13% äussern, sie hätten damit keinerlei Erfahrungen gemacht oder haben keine
Antwort abgegeben.
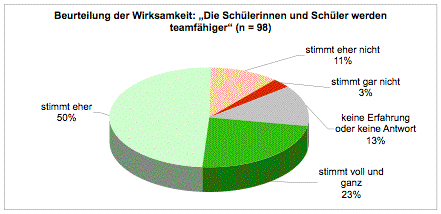
Diagramm 22: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler werden
teamfähiger"
Die
Kreisdiagramme zeigen die Einschätzungen der von uns befragten Lehrpersonen
bezüglich der positiven Entwicklung von verschiedenen Fertigkeiten bei der
Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen. Wir stellen nun diese Einschätzungen
vergleichend dar. Um dies zu tun, haben wir die fünf Antwortkategorien jeweils
mit einer Ziffer codiert. So entspricht die Aussage "stimmt voll und ganz" dem
Wert 1, "stimmt eher" dem Wert 2, "stimmt eher nicht" dem Wert 3, "stimmt gar
nicht" dem Wert 4 und die Aussage "keine Erfahrung gemacht" dem Wert 5.
Die
Mittelwerte und Standardabweichungen werden nun anhand dieser Werte berechnet.
Der Wert 5 wird dabei nicht berücksichtigt. Es werden also nur diejenigen
Wortmeldungen berücksichtigt, die entweder eine Zustimmung oder eine Ablehnung
beinhalten.
Anhand der
Diagramme 23 und 24 stellen wir nun Vergleiche zwischen den Einschätzungen zu
den verschiedenen Aussagen an.
Die Y-Achse
von Diagramm
23 zeigt den Mittelwert der jeweiligen
Einschätzungen und die X-Achse enthält die im Fragebogen enthaltenen
Fertigkeiten, welche die Lehrpersonen bei der Erhebung beurteilten. Es zeigt,
dass die Resultate in zwei Hauptgruppen bezüglich des Grades der Zustimmung
zerfallen. So liegt die Zustimmung bei den Aussagen "Die Schülerinnen und
Schüler lernen selbständiger", "Die Schülerinnen und Schüler kennen ihre
eigenen Stärken und Schwächen", "Die Schülerinnen und Schüler kennen Lernstrategien"
und "Die Schülerinnen und Schüler setzen Lernstrategien bewusst ein" zwischen
den Werten 1.66 und 1.71. Die übrigen vier Aussagen finden zwar ebenfalls
mehrheitlich Zustimmung, aber bei weitem nicht so deutlich.

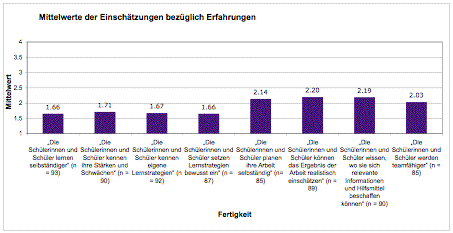
Diagramm 23: Mittelwerte der Einschätzungen bezüglich Erfahrungen
Im Diagramm 24 werden die Einschätzungen im Bezug
auf die Standardabweichung miteinander verglichen. Die Standardabweichung ist
ein Mass für die Streuung der einzelnen Werte in Bezug auf einen Mittelwert.
Die Y-Achse
von Diagramm
24 beschreibt die Standardabweichung
der jeweiligen Einschätzungen und die X-Achse wiederum die im Fragebogen
enthaltenen Fertigkeiten. Die Aussagen "Die Schülerinnen und Schüler lernen
selbständiger", "Sie kennen eigene Lernstrategien" und "Sie setzen Lernstrategien
bewusst ein" weisen vergleichsweise kleine Standardabweichungen auf. Die
Lehrkräfte sind sich also bezüglich der Einschätzung der Wirksamkeit von
metakognitiven Unterrichtsformen in den entsprechenden Bereichen relativ einig.
Die grösste Standardabweichung zeigt sich bei der Einschätzung "Die
Schülerinnen und Schüler werden teamfähiger".
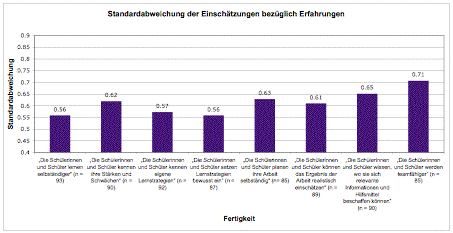
Diagramm 24: Standardabweichung der Einschätzungen bezüglich Erfahrungen
6.3.1.2 Interpretation zu den Erfahrungen
In den
Kreisdiagrammen sowie in Diagramm 23 zeigt es sich, dass die
Einschätzungen der Lehrpersonen mehrheitlich bestätigen, dass sich bei der
Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen positive Auswirkungen bezüglich
verschiedener Fertigkeiten einstellen.
Diagramm
24 zeigt allerdings, dass sich die
Lehrpersonen bezüglich der Wirksamkeit von metakognitiven Unterrichtsformen
nicht gleich einig sind. Die vergleichsweise kleinen Standardabweichungen bei
den Fertigkeiten "Die Schülerinnen und Schüler lernen selbständiger" "Die
Schülerinnen und Schüler kennen eigene Lernstrategien" und "Die Schülerinnen
und Schüler setzen Lernstrategien bewusst ein" zeigen, dass die Einschätzungen
der einzelnen Lehrpersonen bei diesen Aussagen näher beieinander liegen als zum
Beispiel bei der Behauptung "Die Schülerinnen und Schüler werden teamfähiger".
Es ist
auffällig, dass in Diagramm 23 gerade die ersten vier Aussagen eine so starke
Zustimmung finden, während die zweiten vier Aussagen zwar immer noch
unterstützt werden, aber bei weitem nicht mehr so vehement. Das könnte damit
zusammenhängen, dass die Reihenfolge der Aussagen, wie sie auf dem Fragebogen
aufgeführt waren, sich auch daraus ergab, welche der Thesen uns als erste
aufgrund des Literaturstudiums auffiel und für uns am plausibelsten war.
Der Anteil
der Lehrkräfte, welche keine Aussage machten oder angaben, sie hätten keine
Erfahrungen im Bezug auf die entsprechende These gemacht, fliesst wie erwähnt
in die Diagramme 23 und 24 zu Mittelwert und Standardabweichung nicht ein.
Dieser Anteil variert zwischen 5% und 13% über die verschiedenen Thesen
betrachtet. In der zweiten Hälfte der Aussagen, welche deutlich weniger starke
Zustimmung findet, ist der Anteil dabei deutlich höher. Auch hier lässt sich
der Trend bezüglich einer grösseren Uneinigkeit bzw. eine grössere Unsicherheit
über die eigenen Erfahrungen erkennen.
6.3.1.3 Diskussion zu den Erfahrungen
Die
Auswertung zeigt, dass die Mehrheit der Lehrpersonen, welche metakognitive
Unterrichtsformen einsetzen, die Aussagen bezüglich der positiven Auswirkungen
der Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen stützen. Damit lässt sich
Hypothese 5 verifizieren. Sie lautet:
Mehr als
50% der Lehrpersonen, welche bereits metakognitive Unterrichtsformen
ausprobiert haben, bestätigen, dass die entsprechende Fertigkeit durch die
Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen gefördert wird.
Die
Ergebnisse sowie die diversen interessanten €usserungen bezüglich weiterer
Fertigkeiten unter der Rubrik "Sonstige" bestätigen die Ansicht von Guldimann
(1996), wonach Lernexpertinnen und –experten Lernstrategien kennen, diese
gezielt einsetzen können und ihre Stärken und Schwächen reflektieren. Die von
uns befragten Lehrpersonen sind auch der festen †berzeugung und sich zugleich
in diesem Punkt weitgehend einig, dass die Kinder durch den Einsatz von
metakognitiven Unterrichtsformen selbständiger lernen. Dass die Kinder durch
die Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen teamfähiger werden, wie es
Guldimann (1996) sagt, bestätigen die Lehrpersonen ebenso. Die Meinungen gehen
jedoch in diesem Punkt weiter auseinander.
Eine
Lehrperson hat unter der Rubrik "Sonstige" darauf hingewiesen, dass es unter
den Schülerinnen und Schülern grosse Unterschiede gebe. Während einige Kinder
ihr Lernen schon gut reflektieren können, gibt es andere, die damit überfordert
sind. Diese Bemerkung können wir gut nachvollziehen. Es ist davon auszugehen,
dass die grosse Streuung bezüglich der Leistungsunterschiede, wie sie, wie
allgemein bekannt ist, im Bezug auf fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten
anzutreffen ist, ebenso beim Nachdenken über das eigene Lernen Gültigkeit hat.
6.3.1.4 Zusammenfassung zu den Erfahrungen
Lehrpersonen,
welche metakognitive Unterrichtsformen einsetzen, schätzen den Nutzen der Anwendung
solcher Unterrichtsformen bei allen von uns im Fragebogen aufgeführten
Fertigkeiten mehrheitlich positiv ein. Damit lässt sich die Hypothese 5
verifizieren, wonach mehr als 50% der Lehrpersonen, welche bereits
metakognitive Unterrichtsformen ausprobiert haben, bestätigen, die Anwendung
von metakognitiven Unterrichtsformen würden bestimmte Fertigkeiten fördern.
Die
Behauptungen, dass die Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen die Schülerinnen
und Schüler darin unterstützt, selbständiger zu lernen, eigene Stärken und
Schwächen zu kennen und Lernstrategien sowohl zu kennen als auch bewusst
einzusetzen, finden dabei besonders starke Zustimmung.
Die
Aussagen "Die Schülerinnen und Schüler lernen selbständiger", "Die Schülerinnen
und Schüler kennen Lernstrategien" und "Die Schülerinnen und Schüler setzen
Lernstrategien bewusst ein" weisen eine kleine Standardabweichung auf. Das
bedeutet, dass die Meinungen der einzelnen Lehrpersonen in diesem Punkt nahe
beieinander liegen, im Gegensatz zur Standardabweichung der Behauptung "Die
Schülerinnen und Schüler werden teamfähiger", welche zeigt, dass sich die Lehrpersonen
diesbezüglich uneinig sind.
6.3.2
Hindernisse bei der Anwendung von
metakognitiven Unterrichtsformen
In diesem
Unterkapitel suchen wir Antworten zur Einschätzung der Lehrpersonen bezüglich
der Hindernisse beim Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen: Welche
Hindernisse tauchten auf? Was hindert die Lehrkräfte daran, metakognitive Unterrichtsarrangements
auszuprobieren?
Eigentlich
wollten wir an dieser Stelle Unterschiede aufzeigen bezüglich der Hindernisse
beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen zwischen Lehrpersonen, welche
Erfahrungen mit dem Einsatz solcher Unterrichtformen gemacht haben und
Lehrpersonen, welche den metakognitiven Aspekt des Lernens in ihrem Unterricht
nicht berücksichtigen. Wir gingen davon aus, dass seitens der Lehrpersonen, die
in ihrem Unterricht keine metakognitiven Elemente einsetzen, Vorurteile
bezüglich der Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen bestehen, die wir
widerlegen wollten. Da aber leider nur fünf der befragten Lehrpersonen angaben,
noch nie metakognitive Unterrichtsformen angewendet zu haben, können wir keinen
aussagekräftigen Vergleich anstellen und müssen uns daher auf die Beantwortung
der Frage beschränken, als wie gravierend die Lehrkräfte, welche metakognitive
Unterrichtsformen anwenden, die Hindernisse einschätzen, welche beim Einsatz
von metakognitiven Unterrichtsformen auftraten.
6.3.2.1 Analyse der Resultate zu den Hindernissen
Für die
Auswertung der folgenden Diagramme haben wir wiederum die Daten von 98 Lehrpersonen
verwendet. Die Angaben von Personen, welche noch nie metakognitive
Unterrichtsformen angewendet haben, konnten nicht berücksichtigt werden. Unter
der Rubrik "Sonstige" sind verschiedene €usserungen bezüglich weiterer
Hindernisse eingetragen worden, welche bei der Anwendung von metakognitiven
Unterrichtsformen entstanden sind. Die Lehrpersonen gaben unter anderem an,
dass allzu viel Reflexion auf die Schülerinnen und Schüler schnell demotivierend
wirke, dass sie oft den Sinn hinter metakognitiven Arbeitsaufträgen nicht
sehen, dass sie der gegenseitige Austausch über ihre Lernerfahrungen langweile
und sie zum Beispiel im Arbeitsheft oder beim Arbeitsrückblick stereotype,
nichts sagende Sätze formulieren. Eine Lehrperson erwähnte, dass sie unter
Zeitdruck sei, den Lehrplan einzuhalten und jemand bemerkte, dass man selber
immer darauf bedacht sein müsse, den Einsatz solcher Unterrichtsformen nicht zu
vernachlässigen. Eine ISF-Lehrkraft gab zu bedenken, dass die Zeitgefässe im
Unterricht sehr eng seien, da manche Kinder nur einmal wöchentlich kommen und
sich dadurch kaum eine metakognitive Kultur aufbauen lasse. Eine Lehrperson
schliesslich erwähnte, dass der zeitliche Aufwand für die Unterstützung der
Kinder beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen im Laufe der Zeit abnehme.
Je vertrauter die Kinder mit solchen Unterrichtsformen seien, desto weniger
Hilfe bräuchten sie.
Bei der Darstellung
der folgenden Diagramme haben wir dieselbe Reihenfolge gewählt, wie bei der
Auflistung der Hindernisse im Fragebogen.
Diagramm
25 zeigt, dass 73% der Aussage voll
und ganz oder zumindest eher zustimmen, dass der Einsatz von metakognitiven
Arbeitsformen viel Zeit kostet. 24% verneinen dies und 3% haben diesbezüglich
keine Erfahrungen gemacht oder keine Antwort dazu abgegeben.
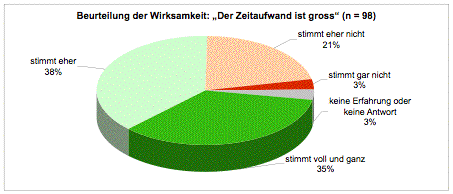
Diagramm 25: Beurteilung der Wirksamkeit: "Der Zeitaufwand ist gross"
Diagramm
26 zeigt, dass 48 % der befragten
Lehrpersonen der Meinung sind, dass es schwierig ist, beim Einsatz von
metakognitiven Unterrichtsformen den †berblick zu behalten. Genau gleich viele
hingegen stimmen dieser Aussage entweder eher nicht oder gar nicht zu und 4%
geben an, damit noch keine Erfahrungen gemacht zu haben oder geben keine
Antwort dazu.
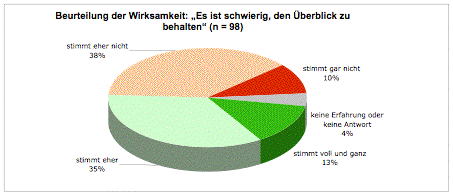
Diagramm 26: Beurteilung der Wirksamkeit: "Es ist schwierig, den †berblick zu
behalten"
Diagramm
27 zeigt, dass 43% der Lehrpersonen
der Aussage "Die Schülerinnen und Schüler sind überfordert" zustimmen,
gegenüber 51% der Lehrpersonen, welche dies verneinen. 6% geben an, keine
Erfahrungen gemacht zu haben oder haben keine Antwort abgegeben. 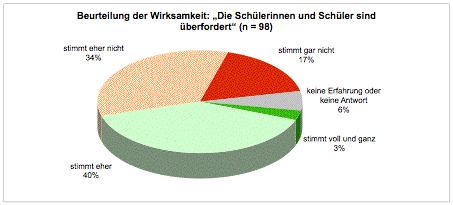
Diagramm 27: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler sind
überfordert"
Diagramm
28 zeigt, dass 56% der Lehrpersonen
der Aussage zustimmt "Die Schülerinnen und Schüler können sich mündlich
oder/und schriftlich zu wenig gut ausdrücken. 36% verneinen diese Aussage und
8% geben an, damit noch keine Erfahrungen gemacht zu haben oder haben keine
Antwort gegeben.
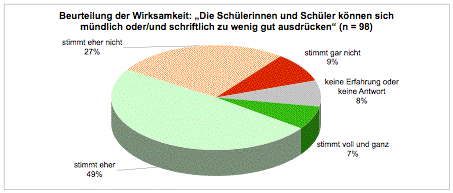
Diagramm 28: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler können
sich mündlich oder/und schriftlich zu wenig gut ausdrücken"
Diagramm
29 zeigt, dass 76% der befragten
Lehrpersonen bestätigen, dass die Schülerinnen und Schüler beim Einsatz von
metakognitiven Arbeitsformen viel Unterstützung brauchen. 20% unterstützen
diese Aussage nicht und 4% haben damit keine Erfahrungen gemacht oder dazu
keine Antwort gegeben.
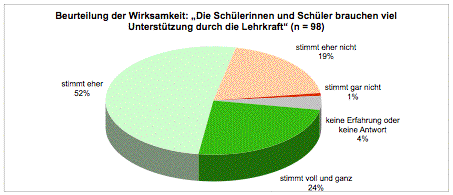
Diagramm 29: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler brauchen
viel Unterstützung durch die Lehrkraft"
Diagramm
30 beschreibt, dass 19% der
Lehrpersonen der Ansicht sind, dass der Lernzuwachs beim Einsatz metakognitiver
Unterrichtsformen im fachlichen Bereich kleiner ist, als im lehrergesteuerten
Unterricht. 68% verneinen dies und 13 % haben diesbezüglich keine Erfahrungen
gemacht oder keine Antwort gegeben.
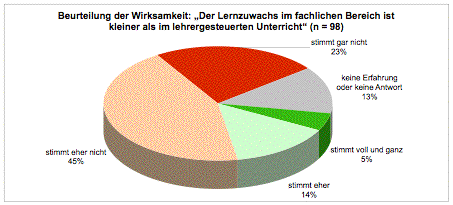
Diagramm 30: Beurteilung der Wirksamkeit: "Der Lernzuwachs im fachlichen Bereich
ist kleiner als im lehrergesteuerten Unterricht"
Die
Kreisdiagramme in diesem Unterkapitel zeigen die Einschätzungen der von uns
befragten Lehrpersonen bezüglich der Hindernisse bei der Anwendung von
metakognitiven Unterrichtsformen. Wir stellen nun Vergleiche zwischen den
verschiedenen Einschätzungen an und haben daher wieder die fünf
Antwortkategorien, die wir im Fragebogen gewählt haben, mit jeweils einer
Ziffer codiert. So entspricht die Aussage "stimmt voll und ganz" dem Wert 1,
"stimmt eher" dem Wert 2, "stimmt eher nicht" dem Wert 3, "stimmt gar nicht"
dem Wert 4 und die Aussage "keine Erfahrung gemacht" dem Wert 5.
Die
Mittelwerte und Standardabweichungen werden nun anhand dieser Werte berechnet.
Der Wert 5 wird dabei nicht berücksichtigt. Es werden also nur diejenigen
Wortmeldungen berücksichtigt, die entweder eine Zustimmung oder eine Ablehnung
beinhalten.
Anhand der
Diagramme 31 und 32 stellen wir nun Vergleiche zwischen den verschiedenen
Einschätzungen der Lehrpersonen an.
Die Y-Achse
von Diagramm
31 zeigt den Mittelwert der jeweiligen
Einschätzungen und die X-Achse enthält die einzelnen Hindernisse, zu denen die
Lehrpersonen bei der Erhebung Stellung nahmen. Diagramm 31 zeigt, dass die Behauptung "Der
Lernzuwachs im fachlichen Bereich ist kleiner als im lehrergesteuerten
Unterricht" mehrheitlich verneint wird, ebenso wie die Aussage "Die
Schülerinnen und Schüler sind durch metakognitive Unterrichtsformen
überfordert". Die Aussagen "Es ist schwierig, den †berblick zu behalten" und
"Die Schülerinnen und Schüler können sich mündlich und/oder schriftlich zu wenig
gut ausdrücken" werden knapp bejaht. Die Behauptungen "Der Zeitaufwand ist
gross" und "Die Kinder brauchten viel Unterstützung durch die Lehrkraft" finden
die grösste Zustimmung.

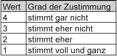
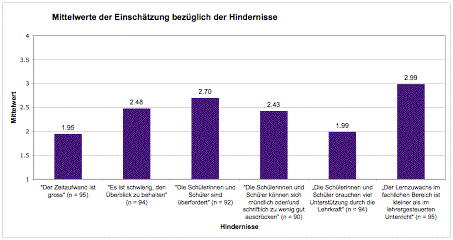
Diagramm 31: Mittelwerte der Einschätzung bezüglich der Hindernisse
Wir stellen
nun mit Diagramm
32 einen weiteren Vergleich dar
zwischen den verschiedenen Einschätzungen bezüglich der Hindernisse bei der
Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen. Die Y-Achse von Diagramm 32 zeigt die Standardabweichung der
Einschätzungen und die X-Achse die verschiedenen im Fragebogen dargestellten
Hindernisse. Die Werte liegen in einem relativ engen Bereich und es lässt sich
keine klare Struktur erkennen. Die Standardabweichung der Aussage "Die Kinder
brauchen beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen viel Unterstützung durch
die Lehrperson" hebt sich als einzige deutlich von den anderen ab, indem dort
die grösste †bereinstimmung in den Antworten der Lehrpersonen sichtbar wird.
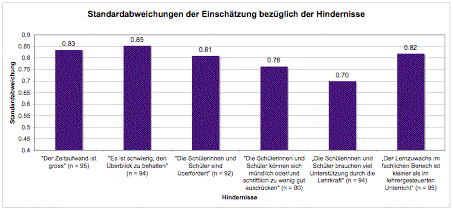
Diagramm 32: Standardabweichungen der
Einschätzung bezüglich der Hindernisse
6.3.2.2 Interpretation zu den Hindernissen
Die
Kreisdiagramme sowie Diagramm 31 zeigen, dass vier der sechs von uns
im Fragebogen aufgeführten Aussagen, bejaht, das heisst, als tatsächliche
Hindernisse wahrgenommen werden.
In Diagramm 31 fällt auf, dass der Mittelwert der
Aussage "Die Schülerinnen und Schüler brauchen viel Unterstützung durch die
Lehrperson" klein ist. Dies bedeutet, dass viele Lehrpersonen der Meinung sind,
diese Aussage stelle wirklich ein Hindernis dar. Die kleine Standardabweichung
bei dieser Aussage in Diagramm 32 gibt dieser Aussage ein noch
grösseres Gewicht, da sie besagt, dass sich die Lehrpersonen diesbezüglich
zusätzlich sehr einig sind.
In Diagramm 31 fällt zudem der kleine Mittelwert
auf zur Behauptung "Der Zeitaufwand ist gross." Dies bedeutet, dass viele
Lehrkräfte auch diesen Punkt als grosses Hindernis empfinden. Da die Standardabweichung
in Diagramm
32 bei diesem Hindernis allerdings
eine der grössten ist, stellen wir fest, dass sich die Lehrpersonen in diesem
Punkt wenig einig sind.
Verglichen
mit den Mittelwerten aus den Einschätzungen bezüglich der Fertigkeiten wie in Diagramm 23 dargestellt ergeben sich
interessante Beobachtungen. Die Zustimmung zur Behauptung, dass der Zeitaufwand
gross ist – die stärkste Zustimmung im Rahmen der Frage nach den
Hindernissen – ist mit einem Mittelwert von 1.95 immer noch erheblich
weniger deutlich als die klarsten Zustimmungen bezüglich der geförderten
Fertigkeiten mit einem Wert von 1.66 bis 1.71.
Die
Streuung der Antworten ist bei der Frage nach den Hindernissen auffällig
grösser als bei der Frage nach den geförderten Fertigkeiten. Der höchste Wert
aus Diagramm
24 mit den Standardabweichungen zu den
Fertigkeiten ist praktisch gleich gross wie der niedrigste aus Diagramm 32 mit denjenigen zu den Hindernissen.
Es besteht also im Ganzen eine wesentlich grössere Heterogenität der
Einschätzungen bezüglich der Hinternisse.
6.3.2.3 Diskussion zu den Hindernissen
Insgesamt
bestätigen die Lehrpersonen folgende Hindernisse: "Der Zeitaufwand ist
gross","Die Schülerinnen und Schüler können sich mündlich oder/und schriftlich
zu wenig gut ausdrücken" "Es ist schwierig, den †berblick zu behalten" und "Die
Schülerinnen und Schüler brauchen viel Unterstützung durch die Lehrkraft".
Die zwei
Aussagen "Es ist schwierig, den †berblick zu behalten" und "Die Schülerinnen
und Schüler brauchen viel Unterstützung durch die Lehrkraft" deuten –wie
wir bereits gesehen haben– darauf hin, dass die Rahmenbedingungen für
metakognitives Arbeiten in einer kleinen Klasse oder Unterrichtsgruppe
begünstigt werden. In einer kleinen Klasse ist es einfacher, den †berblick zu
behalten und die Lehrperson hat mehr Zeit, die Kinder individuell zu
unterstützen. Ein weiteres Hindernis lautet "Der Zeitaufwand ist gross". Wir
sind davon überzeugt, dass metakognitives Lernen Zeit braucht. Doch sehen wir
es als eine Aufgabe der Schule an, bei den Kindern nicht nur Fachwissen sondern
auch das Wissen über das eigene Lernen anzuregen. Diese Haltung widerspiegelt
sich auch in den Forderungen nach den Fähigkeiten des "Lebenslangen Lernens",
wie sie heute ausserhalb der Schule ebenfalls präsent sind.
Der Aussage
"Die Schülerinnen und Schüler können sich mündlich oder/und schriftlich zu
wenig gut ausdrücken" können wir entgegnen, dass sich durch metakognitives
Lernen viele Gelegenheiten ergeben, dies zu üben. Verboom (2004) schreibt, dass
sich Verstehen sprachlich vollziehe. Immer wieder werde sie von Kolleginnen und
Kollegen auf die Schwierigkeiten beim Versprachlichen von Sachverhalten
hingewiesen. Dem entgegnet sie, dass es umso wichtiger sei, die mündliche und
schriftliche Ausdrucksfähigkeit der Kinder von Anfang an kontinuierlich zu
fördern und ihnen die benötigten Begriffe gezielt an die Hand zu geben. Wir
wiederholen an dieser Stelle noch einmal die Aussage einer Lehrperson, welche
in der Rubrik "Sonstige" bei den Erfahrungen bezüglich der Fertigkeiten
ergänzte, dass sich durch die Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen die
Sprachkompetenzen der Kinder erweitern. Ein weiteres Argument zur Entkräftung
dieser Aussage findet sich im Kapitel 6.2.5. Dort wird aufgezeigt, dass in
Klassen mit einem grossen Anteil von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache die
Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen durchaus nicht weniger häufig
stattfindet als in Klassen mit einem niedrigen Anteil, was die Relevanz dieses Hindernisses
zumindest in Frage stellt.
Die
Hypothese zu den gestellten Fragen lautet:
Lehrpersonen,
welche noch nie metakognitive Unterrichtsformen angewendet haben, schätzen die
Hindernisse höher ein als Lehrpersonen, welche bereits Erfahrungen mit solchen
Unterrichtsformen gesammelt haben.
Wie in der
Einleitung zu diesem Kapitel beschrieben, können wir Hypothese 6 nicht veri-
bzw. falsifizieren, da wir zu wenige Daten von Lehrpersonen besitzen, die noch
nie metakognitive Unterrichtsformen verwendet haben.
Wir möchten
aber trotzdem die Einzelmeinungen dieser Lehrpersonen zu dieser Frage in Bezug
auf ein bestimmtes Hindernis darstellen. Es ist nämlich sehr interessant, dass
alle fünf Lehrpersonen angeben, sie befürchten, dass beim Einsatz von
metakognitiven Unterrichtsformen viel Unterstützung nötig sei. Diese
Befürchtung deckt sich mit einer Hinderniserfahrung, die Lehrpersonen
bestätigen, die metakognitive Unterrichtsformen tatsächlich anwenden.
Das
Bedürfnis nach viel Unterstützung durch die Lehrkraft scheint bei der Anwendung
metakognitiver Unterrichtsformen eine Schwierigkeit darzustellen. Es stellt
sich die Frage, ob diese Aussage hauptsächlich für eine "Einführungsphase"
Gültigkeit hat und sich über einen längeren Zeitraum gesehen abschwächt oder ob
sie für die Arbeit mit metakognitiven Unterrichtsformen ganz generell gilt. Wir
fügen hier noch einmal die Meinung einer Lehrperson an, welche unter der Rubrik
"Sonstige" erwähnte, dass die Kinder die Unterstützung beim Einsatz
metakognitiver Unterrichtsformen je länger je weniger benötigten.
6.3.2.4 Zusammenfassung zu den Hindernissen
Insgesamt
stossen die Aussagen "Der Lernzuwachs im fachlichen Bereich ist kleiner als im
lehrergesteuerten Unterricht" und "Die Schülerinnen und Schüler sind
überfordert" bei den Lehrpersonen, welche metakognitive Unterrichtsformen
anwenden, auf Ablehnung. Die restlichen vier Aussagen werden durch die
Lehrpersonen mehrheitlich bestätigt, das heisst, als effektive Hindernisse
angesehen. Die Behauptungen "Der Zeitaufwand ist gross" und "Die Kinder
brauchen viel Unterstützung durch die Lehrperson" finden speziell grosse
Zustimmung.
Die
Standardabweichung der Aussage "Die Kinder brauchen beim Einsatz metakognitiver
Unterrichtsformen viel Unterstützung durch die Lehrperson" ist am kleinsten.
Die Lehrpersonen sind sich also einig darin, dass die Kinder beim Einsatz
metakognitiver Unterrichtsformen grosse Unterstützung brauchen, was diesem
Punkt ein besonderes Gewicht verleiht. Zudem ist es interessant, dass alle fünf
Lehrpersonen, welche keine metakognitiven Unterrichtsformen anwenden, diesen
Punkt ebenfalls als Hindernis einschätzten.
Die
Resultate, wie wir sie bisher in diesem Kapitel präsentiert haben, wurden
hauptsächlich im Hinblick auf unsere Hypothesen betrachtet. Die Antworten der
Lehrkräfte lassen sich aber noch im Bezug auf viele weitere Kriterien und
Fragen hin auswerten, von denen wir einzelnen in diesem Unterkapitel noch
nachgehen werden. Viele weitere Fragen und Folgefragen, wie auch Querverbindungen
zwischen einzelnen Punkten, die ebenfalls interessant gewesen wären, werden
allerdings noch offen bleiben, da der Rahmen dieser Arbeit ansonsten gesprengt
würde.
Ein Thema,
das wir in diesem Unterkapitel noch aufgreifen, ist die Frage, inwiefern die
Anzahl Jahre Berufserfahrung einen Einfluss auf den Einsatz metakognitiver
Unterrichtsformen hat. Eine weitere Frage betrifft das Geschlecht der
Lehrpersonen, die auf unseren Fragebogen geantwortet haben. Lässt sich dort
eine einheitliche Tendenz bezüglich des Einsatzes von metakognitiven
Unterrichtsformen erkennen?
Diese
Resultate werden nun dargestellt, interpretiert und abschliessend
zusammengefasst.
Bezüglich
dieses Aspektes interessiert uns, ob die Anzahl Jahre Berufserfahrung einen
Einfluss auf den Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen haben.
6.4.1.1 Analyse der Resultate zum Aspekt Berufserfahrung
Für Diagramm 33 verwendeten wir die Angaben von 96
Lehrpersonen. Lediglich die Angaben der fünf Lehrpersonen, welche keine Erfahrung
beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen gemacht haben sowie diejenigen
von zwei Lehrpersonen, die keinen Eintrag zur Anzahl Berufsjahre gemacht haben,
konnten wir nicht berücksichtigen. Zur ersten Gruppe, welche 0-10 Jahre in
diesem Beruf arbeitet, gehören 38, zur 2. Gruppe mit 11-20 Dienstjahren 35 und
zur 3. Gruppe mit über 20 Jahre Schulerfahrung 23 Lehrpersonen.
Die Y-Achse
von Diagramm
33 zeigt die Häufigkeit des Einsatzes
metakognitiver Unterrichtsformen gemäss Index und die X-Achse die Zugehörigkeit
zur Gruppe bezüglich der Anzahl Jahre Berufserfahrung.
†ber den
ganzen Zeitraum gesehen lässt sich von der Gruppe, die den Start ins
Berufsleben noch nicht so lange hinter sich hat, verglichen mit den
Lehrkräften, die schon lange unterrichten eine leicht steigende Tendenz
feststellen. Das Diagramm zeigt überdies, dass der Einsatz metakognitiver Elemente
mit Ausnahme der Unterrichtsformen "Metakognitives Fragen" "Arbeitsrückblick"
und "Ich lerne lernen" von der ersten zur zweiten Gruppe abnimmt. Wenn man die
zweite Gruppe mit der dritten Gruppe vergleicht, stellt man fest, dass die
Häufigkeit der Anwendung mit Ausnahme des Ausführungsmodells und der
Klassenkonferenz wieder steigt.

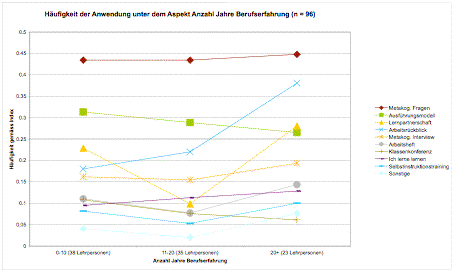
Diagramm 33: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt Anzahl Jahre Berufserfahrung
6.4.1.2 Interpretation zum Aspekt Berufserfahrung
Tendenziell
stellen wir bei Lehrpersonen, welche bereits 11-20 Jahre im Berufsalltag
stehen, in Bezug auf den Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen eine gewisse
Sättigung fest. Wir versuchen uns diese Beobachtung folgendermassen zu
erklären. Motivierte junge Lehrpersonen lassen sich gerne auf neue
Unterrichtsideen ein. Es stellt sich nun die Frage, ob die Lehrpersonen, welche
der zweiten Gruppe angehören, mit den Ideen der Metakognition eventuell weniger
in Berührung gekommen ist, da sie ihre Berufsausbildung zu einem Zeitpunkt
absolviert haben, als dieser Forschungszweig noch kein Thema in den Grundausbildungen
war. Gegen diese Vermutung spricht die Analyse der Frage, welche der
metakognitiven Unterrichtsformen den befragten Lehrpersonen bekannt sind. Dabei
zeigt sich, dass die erste und die zweite Gruppe im Durchschnitt praktisch
gleich viele Unterrichtsformen als bekannt angeben[10].
Eine andere Vermutung wäre, dass sich die metakognitiven Unterrichtsformen im
Unterricht nicht bewähren und die Lehrkräfte der zweiten Gruppe sie deshalb
weniger häufig anwenden. Dagegen spricht wiederum der Anstieg der Häufigkeit,
wie er im Vergleich dazu bei der dritten Gruppe zu erkennen ist. Vielleicht hat
diese mittlere Gruppe aber auch ihr Repertoire an bewährten Unterrichtsformen
gefunden, die ihnen entsprechen, und zeigt wenig Motivation, sich auf Neues
einzulassen.
Uns
überrascht die Gruppe von Lehrpersonen mit über 20 Jahren Berufserfahrung.
Diese Lehrkräfte haben bereits sehr viel Berufserfahrung. Andererseits ist für
die meisten dieser Lehrkräfte wohl klar, dass sie auch in diesem Beruf bleiben
werden, während Lehrpersonen mit kürzerer Berufserfahrung eher auf
Veränderungen in verschiedene Richtungen (Weiterbildungen, Einstieg in
Schulleitungen, Ausstieg aus dem Lehrberuf) rechnen. Zusätzlich ist das
Bewusstsein über die noch verbleibenden Berufsjahre wohl auch nicht so
ausgeprägt wie bei der dritten Gruppe. Insofern ist für sie ein grundsätzliches
†berdenken der eigenen Lehrmethodik weniger drängend. Für die Gruppe mit der
meisten Berufserfahrung ergibt sich daraus die Notwendigkeit, einen erneuten
Effort zu leisten, den eigenen Unterricht zu überdenken. Auf der Suche nach
einem wirkungsvollen Unterricht, der befriedigt, bieten sich die metakognitiven
Unterrichtsformen als ein alternativer Weg der "Wissensvermittlung" an.
Wir haben
versucht, durch die Bildung von anderen Gruppen (z.B. jeweils fünf Jahre
Berufserfahrung gebündelt) und durch die Verknüpfung dieser Resultate mit den
Fragen nach den eigenen Erfahrungen diese oben beschriebenen Thesen zu
erhärten, wobei das Bild dann aber zunehmend diffuser wurde und keine klaren
Tendenzen zu erkennen waren. Das entsprechende Diagramm dazu ist auf der CD-Rom
unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ "Aspekt Berufserfahrung (5-Jahres
Intervall)" einsehbar.
6.4.1.3 Zusammenfassung zum Aspekt Berufserfahrung
Unsere
Erhebung zeigt, dass die Häufigkeit der Anwendung metakognitiver Elemente zur
Hauptsache im Alterspektrum der Lehrpersonen, die 10-20 Jahre im Berufsalltag
stehen, einen Knick aufweist. Uns überrascht dabei die Gruppe von Lehrpersonen,
welche bereits über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung aufweist und häufiger
metakognitive Unterrichtsformen anwendet als Lehrpersonen mit weniger
Berufserfahrung. Könnte es daran liegen, dass Lehrpersonen mit der Perspektive
längere Zeit im Berufsalltag zu stehen ihren Unterricht kritisch überdenken und
nach alternativen Unterrichtsformen suchen?
In diesem
Unterkapitel gehen wir der Frage nach, ob das Geschlecht einen Einfluss auf die
Häufigkeit der Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen hat.
6.4.2.1 Analyse der Resultate zum Aspekt Geschlecht
Für die
Auswertung bezüglich des Aspektes Geschlecht in Diagramm 34 verwendeten wir die Daten von
insgesamt 97 Lehrpersonen. Einzig die Angaben der fünf Personen, welche noch
nie metakognitive Unterrichtsformen angewendet haben und diejenigen von einer
Lehrkraft, welche ihr Geschlecht nicht angegeben hat, konnten wir nicht
berücksichtigen.
Die Y-Achse
zeigt die Häufigkeit des Einsatzes gemäss Index und die X-Achse die
verschiedenen von uns im Fragebogen aufgeführten Unterrichtsformen. Die
Unterrichtsformen "Ich lerne lernen" und "Lernpartnerschaft" werden von
männlichen Lehrpersonen häufiger angewendet, während Lehrerinnen die
Unterrichtsformen "Arbeitsrückblick", "Ausführungsmodell" "Metakognitives
Fragen" und das "Selbstinstruktionstraining" öfter anwenden als ihre männlichen
Kollegen. Bei den Unterrichtsformen "Arbeitsheft", "Klassenkonferenz" und
"Metakognitives Interview" sind bezüglich des Geschlechts der Lehrpersonen
keine wesentlichen Unterschiede feststellbar.

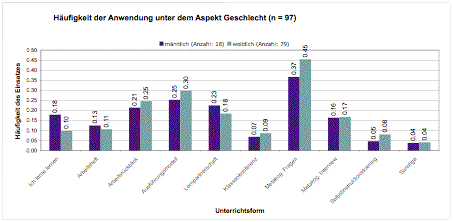
Diagramm 34: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt Geschlecht
6.4.2.2 Interpretation zum Aspekt Geschlecht
Insgesamt
können wir bei Diagramm
34 keine Tendenzen feststellen. Die
einen Unterrichtsformen werden eher von Lehrerinnen, andere eher von Lehrern
bevorzugt und bei manchen sind kaum Unterschiede zu beobachten. Es lässt sich
unserer Meinung nach nichts Schlüssiges darüber aussagen, ob nun männliche oder
weibliche Lehrpersonen häufiger metakognitive Lernformen in ihrem Unterricht
anwenden.
Auch die Auswertung
der Diagramme zu den einzelnen Unterrichtsformen mit den Rohdaten vor der
Umrechnung auf den Index ergibt keine weiteren Resultate. Diese Diagramme sind
auf der CD-Rom unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ
"Aspekt Geschlecht der Lehrperson" ersichtlich.
Dazu kommt
noch, dass unter den Lehrpersonen, welche den Fragebogen beantwortet und
darüber hinaus metakognitive Unterrichtsformen anwenden, nur 18 Männer sind,
was eine zu geringe Anzahl darstellt um zuverlässige Aussagen machen zu können.
6.4.2.3 Zusammenfassung zum Aspekt Geschlecht
Im
Bezug auf den Aspekt Geschlecht haben wir bei der Anwendung metakognitiver
Unterrichtsformen keine Tendenzen feststellen können. Es scheint, dass das
Geschlecht kein Unterscheidungskriterium bezüglich der Häufigkeit der Anwendung
der metakognitiven Unterrichtsformen darstellt.
[1] Nach Kaiser und Kaiser (1999) ist
metakognitives Denken eine Grundqualifikation und wird daher als Protokompetenz
bezeichnet.
[2]
Durchschnittliche Klassengrössen gemäss "Die Schulen im Kanton Zürich, 2004/05"
der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Ausgabe 2005, Themen Klassengrössen,
Altersverteilungen
|
Schulstufe |
Durchschnittliche Klassengrösse |
|
Schulstufe |
Durchschnittliche Klassengrösse |
|
Primarstufe Unterstufe |
20.4 |
|
Oberstufe Sek B/G |
18.0 |
|
Primarstufe Mittelstufe |
20.6 |
|
Oberstufe Sek C |
12.5 |
|
Primarstufe Kleinklasse |
10.6 |
|
Oberstufe Kleinklasse |
10.6 |
|
Oberstufe Sek A/E |
19.7 |
|
|
|
[3] Unter der Bezeichnung Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) verstehen wir Schülerinnen und Schüler, die ursprünglich eine andere Sprache als Deutsch gelernt haben und zu Hause mehrheitlich diese andere Sprache sprechen. Die Schulsprache ist deren Zweitsprache. Es kann sein, dass sie in der Schweiz geboren sind, seit einigen Jahren hier leben oder erst kürzlich eingereist sind.
[4] Diese Information entnehmen wir dem Vernehmlassungsentwurf zur neuen Volksschulverordnung des Kantons Zürich, Abschnitt Schulbetrieb, ¤ 20, vom 20.7.05.
[5] Zwei Mal wöchentlich würde einem Indexwert von 0.4 entsprechen.
[6] Die beiden Kategorien "nie" und "keine Antwort" werden im Folgenden jeweils zusammengefasst. Wir interpretieren dabei die Aussage, dass jemand gar keine Häufigkeit auswählt als Aussage, dass diese Unterrichtsform weder täglich, 2-3 Mal wöchentlich, wöchentlich, noch monatlich benützt wird.
[7] In diesem Fall lässt sich nicht eruieren, auf welchen Teil der Tätigkeit sich die gemachten €usserungen beziehen.
[8] Der durchschnittliche Anteil von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache beträgt gemittelt über alle Regelklassen 29%, gemittelt über alle Klassen und Gruppen aus dem heilpädagogischen Umfeld 42%.
[9] Rüesch (1999) schreibt, dass man in der Fachliteratur unter direkter oder aktiver Instruktion ein Unterrichtsverhalten versteht, dessen Charakteristika die maximale Ausnutzung der Lernzeit und ein durch die Lehrperson gesteuertes Lerngeschehen sind.
[10] Während die Bekanntheit bei der ersten und bei der zweiten Gruppe praktisch gleich ist, ergibt sich für die dritte Gruppe auch im Bezug auf die Bekanntheit, analog zur Häufigkeit der Anwendung, ein höherer Wert.